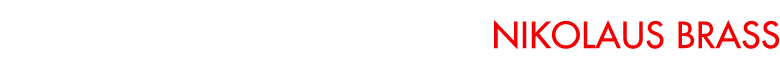KOMPONISTINNEN UND KOMPONISTEN IN BAYERN I NIKOLAUS BRAS
Autoren: Nikolaus Brass, Franzpeter Messmer, David Smeyers, Hans-Peter Jahn, Max Nffeler, KP Werani, Irene Kurka, Franz Reinecke, Beate Zelinsky, Hans Maier, Helmut Rohm
Der 70. Band der Buchreihe Komponistinnen und Komponisten in Bayern ist einem Künstler gewidmet, der einen Weg abseits akademischer Ausbildungsgänge zu einer ganz eigenen Tonsprache fand, welche die Fragilität modernen Menschenseins in einer Musik gestaltet, die den Hörer fesselt und bereichert.
...
Dieser Band macht auf eine so noch nie gehörte und unsere moderne Existenz berührende Musik aufmerksam, die aufzuführen und zu hören ein Erlebnis ist, mit offenen Ohren nicht nur tief berührt, sondern auch verändert.
Franzpeter Messmer
Herausgeber
➔ Auszug aus dem Buch .PDF
2025, Allitera Verlag
ISBN print 978-3-96233-470-3
ISBN ebook 978-3-96233-489-5
Erhältlich im Buchhandel I 24,90€

NIKOLAUS BRASS I TEXTE
Im Vorliegenden Band sind Essays, Gespräche und Kommentare des 1949 geborenen Lindauer Komponisten Nikolaus Brass versammelt, die zwischen 2002 und 2018 entstanden, ergänzt durch Beiträge von anderen Autoren zu einzelnen Werken oder Werkgruppen. Eine Sonderstellung nehmen 'Schwarzenbergs Notizen' ein, poetische Aphorismen, in denen Brass sein Alter Ego Schwarzenberg über Komposition, Leben und Musik reflektieren lässt.
Die Essays fragen nach dem Wandel der ästhetischen Erfahrung angesichts der seit etwa dreißig Jahren immer weiter fortschreitenden globalen Ökonomisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche. In den Gesprächen gibt Brass Auskunft über Arbeitsprozesse, Einflüsse und Inspirationsquellen einzelner Werke und schildert Etappen seiner künstlerischen Biographie. Die Beiträge anderer Autoren leisten als Komplementärquellen zu den Selbstzeugnissen wichtige Fokussierungsarbeit, um bestimmten Konstanten, aber auch Wendungen im Schaffensprozess von Nikolaus Brass deutliche Kontur zu geben.
edition neue zeitschrift für music
2019 Schott Music GmbH & Co.KG, Mainz
ISBN 978-3-7957-1949-4
Erhältlich im Buchhandel I 34,95€
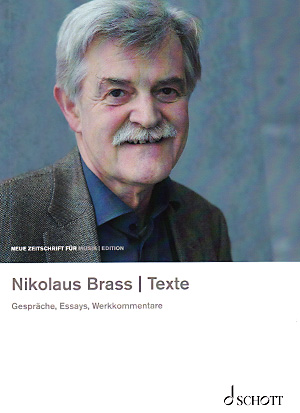
Auszüge aus obiger PublikationDie Mitte ist der Rand. Zum Stand aktueller Ästhetischer Debatten I von Nikolaus BrassKein Rascheln im Wald. Das kränkt. Musik, die – soweit sie ernst genommen werden wollte –, immer Neue Musik war, gehört nicht (mehr) zum Diskursbereich, in dem sich eine öffentlichkeit über ihr Selbstverständnis verständigt. Da haben ihr heute Pop und Trash den Rang abgelaufen. Deren ästhetisches Vokabular ist heute eher „diskursfähig“ als beispielsweise die expressive Potenz komplexer Strukturen eines Streichquartetts von Brian Ferneyhough. Doch wer hat den Diskurs gekündigt? Wer hat sich abgewandt? Und in welchem gesellschaftlichen Kontext vollzog sich diese „Wende“, die heute wieder nach einer erneuten „Wende“ verlangt, weg von einer angeblich nichts mehr zu sagen habenden und damit nicht mehr „diskursfähigen“ (…) „modernen Klassik“ (Rebhahn), hin zu einer nun wirklich neuen „Neuen Musik“, die im um sich greifenden Marketing-Jargon mit unterschiedlichen Etiketten versehen wurde, von denen das der „Diesseitigkeit“ wohl der jenseitigste Begriff seit langem ist. (Diesseitig, das sind wir alle, aber einige sind wohl diesseitiger). Und diese Diesseitigen vermögen – welch Wunder wie – endlich der Musik das zurückzugeben, was sie so sehr entbehrt: „Relevanz“. Keine selbstbezüglichen Strukturbasteleien mehr, sondern Musik, die im Leben steht (irgendwie). Das irgendwie stört noch ein bisschen: Also eröffnen wir eine Debatte, rufen eine stattgehabte Revolution aus (die digitale) und sortieren die Kombattanten. Soweit so bekannt. Ich gebe zu, dass ich erst mit Gewinn und Lust, dann mit zunehmender Unlust und manchmal ärger einige der Beiträge in Positionen, MusikTexte und NZfM der letzten Wochen und Monate verfolgte, in denen es um diese „Debatte“ und einige dieser „Etiketten“ ging. ärgerlich finde ich die uninformierte Ahnungslosigkeit, mit der Harry Lehmann über Musik spricht oder schreibt (zuletzt in seinem Beitrag: Konzeptmusik, in NZfM 1/ 2014, S. 23 ff), lustvoll genoss ich Frank Hilbergs Glosse: „Sie spielen doch nur Lego“ in MusikTexte140 und sehr substanziell empfand ich den Kommentar von Bernd Künzig in der NZfM 2/2014, S. 71: „Kein Problem“. Von der Spitze in die Fläche
Unser neuer Gott: die ökonomische Rationalität
Durchkapitalisierte Subjekte Die zweite Mutante hat Byung-Chul Han in: Müdigkeitsgesellschaft (Matthes & Seitz 2010) treffend als das neue „Leistungssubjekt“ beschrieben. Im postmodernen, „emanzipierten“ Leistungssubjekt, das sich durch selbstauferlegte Selbstoptimierung den Anforderungen einer kapitalistischen „Leistungsgesellschaft“ zur Verfügung stellt, sind, anders als in der Foucaultschen „Disziplinar-Gesellschaft“, Ausbeuter und Ausgebeuteter nicht mehr zwei Akteure eines hierarchischen Zusammenhangs, sondern fallen in einer Person zusammen, die Hierarchie ist quasi ins Ich verschluckt und unsichtbar geworden. Für die „Wertschöpfungskette“ des Spätkapitalismus ist diese anscheinend hierarchielose Selbstausbeutung des Leistungssubjekts viel effizienter als die in Disziplinargesellschaften erreichte Fremdausbeutung des „Gehorsamssubjektes“ (Han). Debatte im Hallraum kapitalistischer Erwartungsoptionen Zurück zum Ruf nach einer Musik, „die was zu sagen hat“, in der sich heutige Lebenswirklichkeit wiederfindet. Der Ruf nach einer solchen Musik als Ersatz für eine Musik, die offenbar nichts zu sagen hat, oder nur wenigen was sagt, oder noch verwirrender: Unverständliches sagt, nicht nur unverständlich ist sondern Unverständlichem Raum gibt: dieser Ruf geschieht im Hallraum der Renditeoption. Keiner, der sich in einer öffentlichen Debatte befindet, kann sich mehr „naiv“ bewegen, er bewegt sich – ob er will oder nicht – in diesem durchkapitalisierten Bewusstseins-Raum. Dieser Raum bestimmt das, was wir vernehmen. Vernehmen wir ein Nichtssagen von Musik, eine Nicht-Relevanz, so ist dies – zumindest auch – diesem besonderen Hallraum geschuldet, dem alles, was resonieren will in dieser Gesellschaft ausgesetzt ist. Der kapitalistische Hallraum – so will ich versuchsweise die öffentlichkeit nennen, in der wir uns denkend, schreibend, komponierend, sagend oder schweigend bewegen –, generiert entweder das große Widerhallen (weil sich rentierend, weil mit gängigem Marketing vermarktbar, weil nischenspezifisch zugeschnitten, weil re- und vor allem multiplizierbar, weil „gängige“ Muster, gängige Klischees, gängige Kanäle, gängige Medien benutzend, oder, oh wie schick: brechend), oder er generiert das große Verschlucken, von dem viele der jüngeren KollegInnen offenbar umgetrieben werden wie vom horror vacui: das Verschlucken des Gesagten, Erarbeiteten erlebt als: Nicht gehört, nicht vernommen, ohne Reaktion, also: nicht „relevant“. Dass der Raum aber das eine resonierend widerhallen lässt und das andere eher verschluckt, muss nicht am Gesagten liegen! Trivial? Es ist nicht so einfach: denn dieser äußere Raum ist schon in mir. Indem ich noch gar nichts über Musik gesagt habe, anscheinend nur über die Bedingungen ihrer Wahrnehmung, die außerhalb der Musik liegen, so habe ich damit doch schon an das Kernproblem heutigen Komponierens gerührt: alle die bewussten oder unbewussten Formanten, welche die Bedingungen öffentlicher Wahrnehmbarkeit geistiger Produktionen herauf- oder herunterregeln, (zum Beispiel, um weiter in der Trivialitätenkiste zu wühlen: die Honorarsätze für Musikjournalisten und deren Unwillen oder Unfähigkeit, sich über die vergütete Zeit hinaus mit Produktionen auseinander zu setzen, über die sie dann nach einmaligem, partiturlosen Hören 80 Zeilen absondern) bestimmen „natürlich“ auch meine individuelle Wahrnehmung und Einschätzung meiner selbst, meiner kreativen Ressourcen, Mittel und Möglichkeiten. ähnlich wie das oben beschriebene Leistungssubjekt hat das kreative Subjekt heute schon lang den inneren Richter über die Verwertungs- und Vermarktungsqualitäten der eigenen Produktion internalisiert. Ich als komponierendes „Leistungssubjekt“ denke mit, welche Merkmale meine Produktion, will sagen: mein Produkt enthalten muss, damit sie/es bemerkbar wird und anderes in der Bemerkbarkeit unterdrückt. Wie „neu“ es sein muss, um in einer auf „Neuigkeiten“ konditionierten „Neu“-gier-Gesellschaft auffallen zu können. Wie es resonieren muss in dem mich umgebenden, früher feudalen oder bürgerlichen, heute explizit kapitalistisch kodierten Hallraum. Dies nicht zu sehen wäre Heuchelei. Und doch:
Gegen die Selbsttäuschung 2. Es gibt ein Leiden an der heute geforderten Aufmerksamkeitsstruktur. Gehorsam dem Satz: von der Spitze in die Fläche ist das heute geforderte Bewusstsein und die heute geforderte Aufmerksamkeit eine flache: möglichst viel, gleichzeitig, ohne Vertiefung. „Multitasking oder Computerspiele erzeugen eine breite, aber flache Aufmerksamkeit, die der Wachsamkeit eines wilden Tieres ähnlich ist“, schreibt Han in Müdigkeitsgesellschaft. „ Die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen und der Strukturwandel der Aufmerksamkeit nähern die menschliche Gesellschaft immer mehr der freien Wildbahn an“. Was auf dem Spiel steht ist klar: „Die kulturellen Leistungen der Menschheit, zu denen auch die Philosophie gehört, verdanken wir einer tiefen, kontemplativen Aufmerksamkeit.“ Diese tiefe Aufmerksamkeit weiche heute mehr und mehr einer ganz anderen Form von Aufmerksamkeit, einer „Hyperaufmerksamkeit, mit raschem Fokuswechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, Informationsquellen und Prozessen“, die zu einer zerstreuten Aufmerksamkeit führten. Diese habe eine sehr geringe Toleranz für Langeweile. Han zitiert Walter Benjamin, der in der tiefen Langeweile einen „Traumvogel“ sieht, „der das Ei der Erfahrung ausbrütet“. Diese tiefe Langeweile sei, so zitiert Han Benjamin, der Höhepunkt der geistigen Entspannung. Während Hektik nicht neues hervorbringe, sondern nur das bereits Vorhandene reproduziere und beschleunige, würde in den „Zeitnestern des Traumvogels gewebt und gesponnen“. Han Benjamin weiter zitierend: „Mit dem Verschwinden der Entspannung verliere sich die ‚Gabe des Lauschens’ und verschwinde die ‚Gemeinschaft der Lauschenden’. Ihr ist die Aktivgemeinschaft diametral entgegengesetzt.“ Erstveröffentlichung in MusikTexte, Mai 2014, # 141, S. 41 |
Nikolaus Brass. Werke für Kammerorchester I von Helmut RohmDie Besprechung der neuen CD auf leporello von BR Klassik. Musik, so unsere alltägliche Erfahrung, hat immer einen Anfang und ein Ende. Ihre Form scheint stets einer Logik von Ablaufgesetze zu genügen. Wollte man als Vergleich ein fließendes Gewässer heranziehen, könnte man ein Bild zweier Quellbäche vor Augen haben, die unterschiedliche Wasser führen, erdig trübes etwa und glasklares. ... mehr |
Lost in translation I von Nikolaus BrassMensch, mach Dich verständlich! Was willst Du eigentlich damit sagen? – (Kennt jeder, so einen „Dialog“) – Menschliche Erfahrung ist nicht übersetzbar. Kunstwerke sind nicht übersetzbar. Meine Musik ist nicht Deine Musik. Kann ich nichts damit anfangen. Wie sollen wir uns denn verständigen? Nicht nur ist meine Erfahrung des Kunstwerks nicht übersetzbar. Auch und gerade das Werk selbst ist unübersetzbar. Es ist nur als das, was es ist, lesbar. Was sich der Sprache verweigert, bleibt unverständlich. Wie soll es einen Raum der Verständigung geben, der nicht in Sprache übersetzt ist? Hm ... Gibt es nichts, das nicht mediatisiert wäre? Kunstwerke sind nicht übersetzbar. In Deinem Begriff der Unübersetzbarkeit nistet etwas, das mir zu schaffen macht. Die Präsenz. Die Gegenwart des Einmaligen. (An der Unübersetzbarkeit erkennen wir Präsenz. Wir ertragen keine Präsenz. Selbst der Schmerz wird enteignet. Wir quantifizieren und messen ihn auf Skalen, machen ihn vergleichbar. „Ah, ich verstehe, ich kann Deinen Schmerz hier ablesen.“
Auch die Musik, wird enteignet. „Ah, ich verstehe, Du verwendest hier die Vergrößerung in der Umkehrung.“ Nichts kannst Du verstehen. Wir haben uns Messer und Gabel unserer Begriffswelt zurecht gelegt und zerlegen damit die Realität, stopfen uns voll damit. Vermeintlich. Selbstversuch: halten wir Messer und Gabel unserer Begriffe mal verkehrt herum, mit beherztem Griff in Messers Schneide und Gabels Spitze, und mit diesem Schmerz in der Hand lasst uns greifen nach dem Vorhandenen: Wir verschlingen’s dann nicht mehr, wir stochern nicht darin herum, schneiden’s nicht klein, nein, wir lassen’s auf Distanz, wir können’s nicht aufspießen, und spüren die Schmerzen der Begriffe, mit denen wir sonst, so selbstverständlich leicht die Realität tranchierten, an uns selbst. Das Unbegriffliche ist das Unbegreifliche (geworden). Ein Verständnis von Musik, jenseits von dem, was an ihr abzählbar ist, setzt auf erkennende Teilhabe am Unbegrifflichen. – (Spätestens hier kommt dann die Entgegnung: laber, laber ...) – Langsam. Diese Teilhabe ist aber nicht zu haben ohne das schmerzhafte Bewusstsein (Messers Schneide, Gabels Spitze fest in der Hand) der Unzulänglichkeit unserer Sprache, Worte, Begriffsbildungen. (Um im Bild zu bleiben: nur mit dem Schmerz in der Hand ist auch erst die Bemühung um das Unbegriffliche redlich). Der Topos von der Unübersetzbarkeit des Kunstwerks verdankt sich (so lese ich) der Romantik. Das Kunstwerk konstelliert eine Wahrheit, die durch die identitätssetzende Sprache der Begriffe nicht berührt werden kann. Heißt das, dass alle „übersetzungsarbeit“ obsolet wäre? Müssen wir nur „blöd affirmativ glotzen“? Nein. „übersetzung“ hat ihren Sinn, wenn sie erkennt, dass ihre Aufgabe nicht in der „übertragung“ sondern in der Kenntlichmachung der „Unübersetzbarkeit“ liegt, in der Präparierung der Differenz, des Unterschieds, des Risses, oder welches Bild man für diesen Sachverhalt bemühen möchte. Wo ist der Aufenthaltsraum der Musik? In der Schrift? In der Idee? In der Aufführung? Im Bewusstsein des Komponisten? Des Interpreten? Des Hörers? Des Vermittlers? - (Manche wollen sie gesehen haben im Klassenzimmer der Analyse, andere in der Raucherecke der Genießer, wieder andere beim Hausmeister, der für die richtige Temperierung der ganzen Chose sorgt, andere beim Direktor, wo sie sich schick gemacht hat, das kleine Luder etc., etc., ... wir sind alles vorlaute Petzen) – Natürlich gibt es keinen Aufenthaltsraum der Musik. Und doch ist sie „irgendwo“. Offenbar ist Musik in einem Raum, den man mit Worten nicht betreten kann, das heißt auch mit Begriffen nicht bestimmen kann, dessen Anerkennung aber konstitutiv ist für den Umschlag von Kenntnis in Erkenntnis, wenn wir von Musik reden wollen. Der Band 48 der Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung, Darmstadt, trägt den Titel: „Sinnbildungen – Spiritualität in der Musik heute.“ Hier habe ich Wegbeschreibungen gefunden zum „Ort“ der Musik, die mir sehr einleuchten. In seinem Beitrag: „Stille als Ereignis – zur Ortschaft des musikalischen Geschehens“ lässt Dieter Mersch das Denken nicht vom Etwas herkommen, , sondern vom Nichts, der Stille: in der Leere „zeigt sich Sein als Ereignis, ‚Ereignung’, und rückt das Geschehnis in seiner jeweiligen Singularität in den Fokus, wovon jedes in seiner Einzigartigkeit sein eigenes, besonderes Zentrum bildet“ (S. 50). Die herkömmliche Ordnung der Zeit sei eine Ordnung der Darstellung. (Wir konstruieren Zeit indem wir einen Punkt auf dem Zeitstrahl eintragen und die Entfernung von einem anderen Punkt auf dem Zeitstrahl messen). Zeit werde so in unserem Bewusstsein grundsätzlich durch etwas repräsentiert, das eben nicht Zeit ist, sondern als etwas „Bemessenes“. (Sie ist mediatisiert). Erfassbar sei aber Zeit auch „als Gabe“, sie gibt eine Ereignis. „Als indifferente Dauer bietet sie nichts als den Ort oder die Möglichkeit eines Geschehnis“ (a.a.O.). Eine ästhetik des Ereignisses bringe nichts zum „Ausdruck“ sondern lasse „erscheinen“. Ihr eigne als Struktur die „Passibilität“, die Durchlässigkeit, eine Struktur die „entgegennimmt, dass geschieht, nicht vorgibt, was geschieht“ (a.a.O.). Diese Sicht biete nach Mersch „die Absehung von der Struktur des Medialen“ (weg vom Vermittelten hin „zur reinen Performanz der Ereignung“). Denn kein Medium erlaube die Darstellung von Nichts. Medien bewirkten stets nur die Transformation von Etwas, und zwar so, „dass sie die Gegebenheit von etwas voraussetzen“ (a.a.O.). Die ästhetik des Ereignisses schärfe aber den Blick für das „Dass“ des Ereignisses und nicht so sehr für das „Was“. Und damit rücke das „Dass“ des eigenen Seins in den Focus. An einen ganz ähnlichen Ort gelangt im selben Heft Hans Zender mit der Frage: Spirituelle Musik – was ist das? Spiritualität in der Kunst bzw. in der Musik hat nach Zender nichts mit Gefühl, Funktion oder inhaltlichen Bezügen zu tun. Spirituelle Kunst findet sich zwar auch als sakrale Kunst, hat aber diesen Raum längst transzendiert. An Stelle all dieser konventionellen Merkmale trete etwas anderes: Beim Betrachter/Hörer erwecke das sich ereignende Kunstwerk nachdrücklich das Bewusstsein der eigenen Präsenz in Raum und Zeit. Das Kunstwerk habe sich gesammelt zur ikonischen Präsenz und erzeuge im Rezipienten eine analoge Sammlung zu eigener Gegenwärtigkeit und das ohne die Verwendung von selbstbezüglichen bildnerischen Formen oder von hinweisenden bzw. erklärenden Symbolen. Das Kunstwerk werde zum Ereignis. Und dieser Bereich der reinen Präsenz sei ein von jeder Sakralität, Konfession oder Symbolik unabhängiger Bereich. „Musik erzeugt die Gegenwärtigkeit von Zeit, ihre Dauer – d. h. das Bewusstsein von Zeit in ihrer Präsenz“ (S. 32). Diesen Raum der „Präsenz“ sieht Zender als den Raum der „Genese unseres Bewusstseins“. In der Zen-Mediation ist es der Raum des „Denkens des Nichtdenkens“. Nach Zender sind alle Künste, Riten und Religionen „übungswege, um dieses geistige Zentrum des Menschen zu entwickeln und in Funktion zu halten“ (a.a.O.). „Einen Zugang zur Ebene der Spiritualität zu finden, bleibt für den heutigen Künstler die schwierigste aller Aufgaben und verlangt von ihm einen Bruch mit allen „bürgerlichen“ Vorstellungen von Kunst“ (a. a. O.) Zender meint damit die Vorstellung vom Kunstwerk als objekthaftem Gebilde, als Selbstdarstellung des Künstlers, als Gefühls- und Trostspender, wie auch die Lossagung vom Kunstwerk als Erkenntniszusammenhang, der Abschied vom Kunstwerk als Ware, als Kommunikations- und Propagandamittel. In der vollkommenen Zweckfreiheit der Kunst, die auf die reine Präsenz ziele und aus der reinen Präsenz komme, sieht Zender ein Erbe der europäischen Mystik. Sie habe nicht nur den Grund des neuzeitlichen Subjektivismus gelegt, „sondern auch die Keime, diesen zu übersteigen“. (...) „Die überwindung des Subjektivismus ist eines der Hauptthemen der modernen Kunst, wenn nicht ihr Zentralanliegen“. Für Zender ereigne sich hier der „Treffpunkt von Moderne und Mystik“. Es gehe hier um eine ganz bestimmte Erfahrung von Fort-Schritt: vom Subjektivismus fort zu schreiten in einen transsubjektiven Bereich, „in dem ratio, empfindendes Temperament und individueller Geschmack nicht mehr die alleinigen Träger geistiger Prozesse sind“.
Können wir jetzt weiter reden? Verstehst Du, was ich meine? Ich meine, es gibt neue (alte) Wege zum Ort der Musik. Auf diesen können wir die Musik „aufsuchen“, ohne sie zu einem „Möbel“ in unserem angestrengten individuellen Ausstattungstheater zu machen. (Und ohne nach der übersetzung zu fragen, was sie denn als dieses Möbelstück zu bedeuten habe.) Alle diese Wege heißen: es gibt keinen Weg. Es gibt nur die Gegenwart. Nur die Gegenwart meines wahrnehmenden Bewusstseins. Und die zu spüren wäre schon viel in einer Welt „des permanenten Boulevards“, in der auch die Kritik schon längst nicht mehr Distanz wahrt, sondern „Agentur zur Bestätigung der landläufigen Geschmackspräferenzen“ geworden ist (Thomas Steinfeld in der SZ an Weihnachten). „Alles muss durch den Flaschenhals der Quote!“ – so sein Befund. Na denn Prost! Neue Musikzeitung, Februar 2009, S. 5 |
A tempo I Sein und Schein I von Nikolaus Brass
Ich weiß nicht, warum ich immer wieder darauf zurück komme: Warum bewegt mich, dass etwas ist, mehr als die Frage, was etwas ist? Hörerlebnisse der letzten Wochen: „Voci“ von Franco Donatoni (Deutschlandradio Kultur), Benedictus aus Beethovens Missa solemnis (Karajan-Produktion 1966), Messiaens Des Canyons aux Etoiles (Münchener Philharmoniker), „Gesänge der Frühe“ (alter Mitschnitt auf Kassette eines Schumann-Abends von Pollini in Salzburg). Kindliche Reaktion: alles das gibt es! Diese Musik gibt es! Es ist menschenmöglich. Es gibt diese Ungeheuerlichkeit des Erfundenen, Gefundenen, Formulierten. Es gibt dieses Hörbare. Es begeistert mich, Herrliches zu hören: „Gesungene Zeit“ von Wolfgang Rihm, die Hingabe an die Endlosigkeit der Linie. Und Unerhörtes, wirklich „neue“ Musik: Wolfgang von Schweinitz’ „Plainsound glissando Modulation, Raga in reiner Stimmung für Violine und Kontrabass“, gerade beim BR dank des beharrlich unauffällig tätigen, dafür umso mehr bewegenden Redakteurs Helmut Rohm produziert – ein unvergleichliches Klingen: Tonhöhen, Intervalle, Konsonanzen, wie ich sie noch nie vernahm, ein instrumentales Juchzen und Jodeln der Extraklasse. Wir kriegen durch die Kunst keine andere Welt, als die wir haben. Wir erfahren die Welt aber anders. Keine andere Welt, aber die Welt anders: Das ist keine Weltflucht. In der Kunst, in der Musik erleben wir ein „Erscheinen seiner selbst“, nicht nur ein Zeigen, sondern ein „Sich-Zeigen“ – so formuliert es Martin Seel in: „Die Macht des Erscheinens“ (Suhrkamp Taschenbuch 2007). „Der ästhetische Schein entspringt einem Erscheinen, das nicht scheinhaft ist.“ Seel: „Es geht um nichts weiter als darum, etwas im Prozess seines Erscheinens zu vernehmen. ästhetische Wahrnehmung lässt sich auf die phänomenale Individualität – und damit auf die unreduzierte sinnliche Gegenwärtigkeit – ihrer Gegenstände (...) ein.“ Auf S. 25 steht der wunderbare Satz: „Die ästhetische Reaktion: sie hält sich nicht ans Festhalten.“ So beim Hören wach bleiben. So beim Komponieren wach bleiben. Sich nicht ans Festhalten halten. Nur so werden wir dem, was erscheinen will, gerecht. Gerecht im Wunder seines Erscheinens. Neue Musikzeitung, März 2009, S. 9 |
a tempo I Für wen komponieren Sie eigentlich? I von Nikolaus BrassEs gab einmal eine Sendereihe im Hessischen Rundfunk unter dem Titel: Für wen komponieren Sie eigentlich? Interviews mit Henze, Kagel, Nono, Schnebel etc. Ich hatte mir als Student die Buchveröffentlichung aus der „Reihe Fischer“ gekauft, Anfang der 70er Jahre. Hansjörg Pauli war der Sammler und Frager. Ich weiß die Antworten nicht mehr, in der Erinnerung geblieben ist mir aber ein besonderer Beiklang dieser Frage. Bemerkenswert an der Frage ist das hinten angestellte: eigentlich. Für wen komponieren Sie eigentlich? Der ganze Zwang der Rechtfertigung eines fragwürdig luxuriösen Tuns konzentrierte sich (für mich) in diesem eigentlich. Ohne das eigentlich wäre die Frage offen: Für wen komponieren Sie? Das eigentlich fordert(e) heraus: und in den 70ern hieß das: wo ist die gesellschaftliche Relevanz, das kritische Erkenntnispotential, die revolutionäre Tat? Es war damals klar: eigentliches komponieren ist gesellschaftsveränderndes Handeln. Wusste man diesem drängenden eigentlich nichts entgegenzusetzen, geriet man schnell in den Verdacht der gedankenlosen Unaufgeklärtheit. Und heute? Reinhard Schulz hat in der letzten NMZ (Ausgabe 3) den „Niedergang des Utopischen“ beschrieben, sehr zutreffend, wie mir scheint. Vor allem arbeitet er den Geschichtsverlust eines allgemeinen Bewusstseins heraus, dem das Heute nicht als ein Gewordenes – und damit grundsätzlich transzendierbares – erscheint, sondern lediglich als ein Ort, an dem man sich – so gut es eben geht – einrichtet. Zitat: „Wer den Begriff der Utopie für sein Schaffen tilgt, wer nur im Gegenwärtigen ohne visionäre Ausblicke herumplantscht, der wird kaum den Mut aufbringen, künstlerisch das Außerordentliche zu wagen. Nur da aber, im radikal Anderen, wird Geschichte fortgeschrieben, wird das Feuer weitergereicht, das wir als Auftrag von den früheren Generationen erhalten haben. Heute droht diese Flamme im sauersoffarmen Mief des bloß Gegenwärtigen zu ersticken.“ Am Terminus des „bloß Gegenwärtigen“ möchte ich andocken. Die Diagnose: „Verhaftet sein im bloß Gegenwärtigen“ bietet auch eine andere Prognose an. Lassen wir probehalber das „bloß“ weg. Vielleicht liegt dann gerade im heute sehr geschärften Bewusstsein für das (bloß) „Gegenwärtige“ gerade das utopische Potential. Bietet nicht die recht verstandene Erfahrung des „Gegenwärtigen“ die einzige Möglichkeit, Wirklichkeit zu erfahren? Ich meine eine Wirklichkeit, die nicht „event“ ist, also Inszenierung, sondern „wirkliche Wirklichkeit“. So verstanden, ist es nicht die Erfahrung von Gegenwärtigkeit, die uns auf das Wunder unserer Existenz hin öffnet? Dass dieses „bei sich sein“ oder „zu sich kommen“ aber nur augenblicksweise gelingt und ständiger Pervertierung ausgesetzt ist, liegt in dieser Erfahrung nicht etwas von dem seelischen Antrieb, den Bloch im „Prinzip Hoffnung“ vermutete? Wenn ich Musik höre – und sich die Frage anschleicht: Für wen hat er (oder sie) das eigentlich komponiert? – was fällt mir dazu ein? Die großen Stücke der Weltliteratur (und das gilt jetzt von Ockeghems missa prolationum bis zu Nonos Prometeo): nicht geschrieben für unser Verständnis, sondern für unsere Verstehensfähigkeit. Für ein von uns zu entwickelndes Potential unserer selbst. Beethovens op. 135 und Zimmermanns „Requiem für einen jungen Dichter“ sind nicht (nur) für unser eingemeindendes Verständnis, sondern für unsere, erst am jeweiligen Gegenstand des Interesses zu entwickelnde Verstehensfähigkeit entstanden. Eigentlich sind sie für eine Zukunft von uns selbst entstanden. Der Maler Gerhard Richter sagt im Interview mit Eva Karcher (SZ vom 14./15. 3.09): „Mir ist es immer wieder passiert, dass ich gerade gelungene Bilder für völlig missglückt hielt, weil ich sie nicht verstanden habe.“ Wohl gemerkt: er spricht über eigene Arbeiten. Kunst entsteht, um auch die eigene Verstehensfähigkeit des Künstlers zu entwickeln.
Und was ist es, das wir (noch) nicht verstehen? Oder nicht mehr? Könnte es das sein, was wir Schönheit nennen, ohne je zu begreifen, was sie ist?
Schubert, für wen hat er eigentlich komponiert?
Neue Musikzeitung, April, 2009, S. 8 |
Diskretion – bitte Abstand halten I von Nikolaus BrassDer einzige Ort, an dem im öffentlichen Raum kenntlich um Diskretion gebeten wird, ist – neben dem katholischen Beichtstuhl – der Bankschalter. Galt die Ehrfurchtsbezeugung des Abstands traditionell dem Heiligen (Altarstufen bitte nicht betreten) , so ist unser heiliger Ort heute – der Schalter. Früher: Der Mensch vor Gott. Heute: Der Mensch vor dem Geld.
Abstand und Diskretion bei Geldgeschäften: Hier mag noch die alte anale Fixierung mitschwingen, die Freud beschrieb. Schamgefühl bei Gelddingen, ein Relikt aus alten Tagen. Sonst sind wir mit Diskretion nicht so zimperlich. Nicht in Gefühlsdingen, nicht im privaten Austausch. Laut herrscht hier ein medial perpetuierter Voyeurismus, der alle Lebensbereiche penetriert.
Neue Musikzeitung, Mai 2009, S. 10 |
a tempo I Die Belebung der toten Winkel I von Nikolaus Brass I 17. 5. 09Beliebt ist die Bedeutsamkeit. Ich wusste zwar nicht was „hohe Lebensstunden“ sein sollten, ich war aber – 12 oder 13 Jahre alt – fest entschlossen, mein Musikhören, wann immer und wo immer, zu einer „hohen Lebensstunde“ zu machen, beispielsweise auch, wenn ich müde nach der Schule nach Hause kam, den Mittags-Tisch decken sollte und dabei eine der Phonoklub-Platten auflegte, und zwar mindestens Beethovens Neunte, sehr zum Verdruss meiner Geschwister und anderer Hausbewohner. Aber mit dieser „Verstärkung“ im Rücken bei voller Lautstärke aus der Grundig-„Musiktruhe“ schaffte ich auch das öde Tischdecken mit Schwung. Ich hatte damals noch keine Ahnung, auf welchen Leim ich da gegangen war. Einem gesellschaftlicher Alleskleber, so zu sagen: Dem Leim der Bedeutsamkeit, einem Bindemittel, das „Erhebungsbereitschaft“ weckt, pflegt und – in den meisten Fällen – missbraucht zur Verklärung falscher Zustände. Erst später habe ich dann bemerkt, wo überall und immer – nicht nur im bürgerlichen Wohnzimmer – dieser Kleber am Werk ist. Not tut die Nüchternheit. Ich zitiere einen längeren Abschnitt aus Genazinos erster Vorlesung, weil sie mir geradezu paradigmatisch auch eine Wahrheit über Musik und die an Musik zu gewinnende Anschauung der Wirklichkeit, und damit etwas über „Authentizität“ aussagt. Authentizität jenseits jeder Bedeutungshuberei. „Ich begann, in aller Unschuld und in aller Stummheit, mit dem Foto einen Dialog. Auch das Bild spielte vor meinen Augen mit seiner Zerstörung. Ich konnte nicht klar unterscheiden: Orientierte sich meine Empfindung am Tod der Frau oder am Zerfall des Geldbeutels? Ich nahm Teil am Versinken der Dinge, das in zwei Fällen gerade endgültig wurde. Die verrottenden Gegenstände unterhalten, indem sie untergehen, ein Verhältnis zum Tod. Indem ich sie dabei betrachte, nehme ich teil am Tod der Dinge und damit auch an meinem eigenen vorgestellten Verschwinden. Diese Erfahrung wehre ich ab, weil sie nicht auszuhalten ist. Indem ich sie abwehre, lasse ich sie in einer fragmentierten, verkrüppelten Form dennoch zu. Die defizitäre Krüppelform der Vorstellung unseres Verschwindens ist vermutlich die einzige authentische. Wir verschwinden als phantasiertes Fragment und leiten davon eine krüppel-ähnliche Selbsterfahrung ab. Unser zukünftiges Nicht-mehr-da-sein sitzt und geht und steht neben uns und lässt sich als Abbruch dennoch nicht fassen. In diesem Fernruf des Verschwindens nistet die poetische Empfindung.“ Und weiter: „Im Verschmelzen des Wirklichen mit seiner eigenen Auflösung ereignet sich die Selbstschöpfung des Poetischen ... Man kann das Poetische einen gemeinsamen Blitzschlag von Zeitempfindung und Dingempfindung nennen.“ Eine wunderbare Selbstaussage von Literatur über das Vermögen von Literatur, „Wahrheit“ erscheinen zu lassen. Ich lese diesen Text aber auch als einen Text über Musik. Wir müssen nur „Gegenstände/Ding“ ersetzen durch „Klang/Ton/Material“ und „Beobachten“ durch: „Hören/ akustisches Befragen/wahrnehmen“, und wir erfahren, was Musikerfahrung ist. Das Poetische als gemeinsamer Blitzschlag von Ding(=Ton)-Empfindung und Zeitempfindung: ist das nicht die treffendste Umschreibung dessen, was erlebend beim Komponieren und damit auch beim Hören von Musik geschieht? Dieser Blitzschlag ereignet sich unabhängig von „Gemeintem“, „Gewolltem“ und „Bedeutendem“, bzw. er ereignet sich nur dort, wo dieses fehlt! Nur dank eines achtenden Umgangs mit der Wirklichkeit – und das heißt der Zeitlichkeit – jedes einzelnen Phänomens, welcher Provenienz auch immer, kann diese „Epiphanie“ – wie Joyce es nannte – im Kunstwerk erscheinen. Kommt das Gewollte, die „Bedeutsamkeit“ vom Autor aktiv ins Spiel, ist das Spiel aus – und es handelt sich um ein Spiel, vielleicht um eine heiliges Spiel . Umgekehrt heißt das auch: Wo dieses Nachspüren der Zeitlichkeit und Dinglichkeit fehlt, ereignet sich auch nicht „das Poetische“. Genazino schreibt von einer „gewissen somnabulen Sicherheit“, mit der „Dichter und Kinder das Poetische an seinen Nistplätzen aufsuchen“ und „Verhältnisse der freundlichen Belauerung“ eröffnen. Voraussetzung ist dazu „die Offenheit der Weltteilnahme“, die der Dichter mit dem Kind teile. „Wie das Kind nimmt der Dichter Kontakt mit Details und Dingen auf. Er muss in der Lage sein, mit diesen in längere Versenkungspausen einzutauchen, auch wenn nicht klar ist, worin sich der poetische Mehrwert einer Versenkung zeigen wird.“ Gerde dieser letzte Halbsatz scheint mir der wichtigste Gedanke, denn nur das offene, unabsichtliche „Nichtwissen“ bahnt dem Poetischen – und damit dem Lebendigen – den Weg ins Kunstwerk und feit uns vor der Erstarrung des Wissens. Neue Musikzeitung, Juni 2009, S. 4-5 |
a tempo I Kuscheln in der Krise? I von Nikolaus BrassIn der derzeitigen Krise hätten „sanfte“ Gesellschafts- und Wirtschaftsutopien Konjunktur, so unlängst die Süddeutsche Zeitung in einem Feuilleton. Zitiert wurden Stimmen, die im überzeugungston der Marktliberalen abschätzig meinten, nun würde wieder unter der Decke des ach so schlechten Großen Ganzen hingebungsvoll im Kleinen „gekuschelt“, statt sich damit abzufinden, dass der Kreislauf des globalen Kapitalismus eben mal Opfer verlange. Schick sei jetzt das Kleine und überschaubare, defensive Sinnstiftung eher gefragt als aggressives Problemlösen. So abschätzig redet gerne ein schlechtes Gewissen, das nicht wahr haben will, dass sein Einschwingen in eine kollektive Größenfantasie mit der Wahnvorstellung von stetigem Wachstum in endloser Beschleunigung, Vergrößerung und Akkumulierung, härtesten Schiffbruch an der Wirklichkeit des sozialen Lebens erlitten hat. Kein gesunder Lebensvollzug kennt stetiges Wachstum. Jedes Wachstum ist an sein Gegenteil, die Apoptose, gekoppelt. Nur maligne Wachstumsprozesse wachsen ungehemmt, und dies auf Grund einer Entkoppelung von bremsenden und stimulierenden Impulsen, die im Gleichgewicht das Leben garantieren. Diesen entkoppelten Zustand nennt man Krebs. Und Krebs nennt man „bösartig“. Das Bösartige der bisherigen gesellschaftlichen und ökonomischen Theorie und Praxis erleben wir gerade. Dazu gehört auch das Lächerlich-Machen von Alternativen.
Was heißt das für die Kultur, und hier interessiert uns primär die Musik? Und wenn schon, was heißt das für die „Neue Musik“? Sozialer Sinn Lebendiges Tun bildet immer eine soziale Struktur. So auch Musik. Musik bildet immer eine soziale Struktur. Musiker, Publikum und Veranstalter bestimmen, in welcher Weise sie interagieren möchten. Das Wie der Interaktion bestimmt die Art der sozialen Struktur, die sich ergibt. Dieses Wie ist nicht unabhängig von gesellschaftlichen Normen, es kann aber auch explizite Gegenentwürfe bieten und somit „Modell stehen“, für einen neuen, anderen Sinn, und dem gesellschaftlich sanktionierten Credo („Groß ist besser als klein“, „Profit ist alles“, „Hol’ heraus was herauszuholen ist“, „Masse vor Klasse“ etc.) entgegen stehen. Ernsthafte Musik – und ich wähle diesen anscheinend überkommenen Ausdruck bewusst – Ernsthafte Musik (gleich welcher Epoche) zielt (für mich) auf d i e ideale soziale Struktur, da sie Menschen achtungsvoll entgegentritt und sie in Achtsamkeit verbindet. Für Achtsamkeit sagte man früher: Liebe. Achtsamkeit als der zentrale übungsweg aller Kulturen zum Erkennen des Gegebenen, führt uns zu uns selbst, zum andern und zur Welt. Musik-Denken, Musik-Schreiben, Musik-Spielen, Musik-Hören ist undenkbar ohne Achtsamkeit, ohne ein Versammeltsein nach innen u n d außen. Dieses Versammeltsein bringt uns mit uns selbst und dem anderen in Berührung. Das ist der soziale „Sinn“ von Musik. Und der „soziale Sinn“ von Neuer Musik.
Vielleicht wird das wirklich Neue einer „Neuen Musik“ im Erleben eines neuen „sozialen Sinns“ liegen, und vielleicht hat sich das wirklich Neue in der „Neuen Musik“ schon längst gebildet und kommt nicht mit dem Imponiergehabe „Materialfortschritt“, nicht mit der Perfektionierung des apparativen Aufwands, mit dem wir unsere Musik „kritiksicher“ machen. Vielleicht kommt das Neue viel mehr aus einem „neuen“ Bedürfnis nach neuem Sinn, in „schlanken“ Formen der Musikvermittlung, der Konzertorganisation, der Netzwerkbildung und in der Beteiligung der Menschen, die durch Musik berührt werden wollen und sich erfahrungshungrig nach authentischem Ausdruck jetzigen Lebens sehnen. Vielleicht ist das Neue schon längst da. Neue Musikzeitung, Juli 2009, S. 8 |
Die Abdankung der Werke I von Nikolaus BrassDie Fragwürdigkeit „des Werks“ ist common sense und eine der ideologischen Selbstvergewisserungen der Moderne. Ihr Misstrauen gegenüber Werk und Schöpfer ist konstitutiv für ein Selbstverständnis, das sich in der als notwendig erlebten radikalen Abkehr von Tradition definiert. Das Kunst-Werk ist angezählt, das Konzept Sieger nach Punkten. Doch ist die Lage so klar? Denn eigentümlicherweise ist das Werk trotz des Siegeszugs der Concept Art nicht totzukriegen. Ist das nur die Frucht eines verlogenen Kulturbetriebs oder ist „etwas“ im Werk am Werk, das seine Selbstaufhebung immer schon betrieben hat und es somit quasi imprägniert gegenüber den Attacken der Konzeptkünstler und gibt es vielleicht „etwas“ – noch in der Sinn-offensten Installation –, das zum Werkhaften drängt und die List des Konzeptualisten überlistet? Im Folgenden suche ich einige Pfade im ideologischen Wald zwischen den umgestürzten Riesen der Tradition und dem Dickicht der Gegenwart. Dass es wirklich so eindeutig bestellt sei mit der Unmöglichkeit der Werke, ist eine Täuschung. Denn das Werk selbst ist – wenn es Werk ist – seine eigene Unmöglichkeit, seine eigene Aufhebung. Darin gleichen sich „die Werke“. Die Abdankung der Werke vollziehen sie selbst. Nur im Werk kann das Werk abdanken. Dazu bedarf es nicht der Moderne. Der Kampf der Moderne gegen „das Werk“ war ein (notwendiger) Kampf gegen die Ideologisierung des Werks, in seiner Totalität aber selbst Ideologie und Erfüllungsgehilfe einer auf Entsubjektivierung zielenden gesellschaftlichen Tendenz (dies nicht zuletzt unter der Fahne der enthemmten Subjektivität). Diese These möchte ich andeutungsweise exemplifizieren. Es geht nicht nur um Musik, aber auch. Ausgang Die Frage nach dem „Werk“ zu stellen, scheint heute vielerorts obsolet. Eine „überwundene“ Fragestellung sozusagen. Verfolgt man beispielsweise die Kommentare und Kritiken der einschlägigen Festivals zeitgenössischer Musik, so kann sich das „Konzept“ jeder publizistischen Aufmerksamkeit sicher sein. Versuche, heutiges Musikschaffen an dem so schwierig zu kategorisierende Werkbegriff zu messen, werden in forschem Post-Adornismus dem „Muff von 1000 Jahren“ überantwortet. ähnliches ließe sich für den Bereich der bildenden Kunst konstatieren. Wie oder Was? Spricht man über den Stand des Komponierens, Schreibens, Malens etc., wird fast ausschließlich die Verhaltensebene fokussiert, selten die Erfahrungsebene. Aktuelles Beispiel ist hier Jörg Heiser in seinem eben erschienenen Buch Plötzlich diese übersicht. Was gute zeitgenössische Kunst ausmacht. Er schreibt: „Wenn jemand sagt, das Kunstwerk handle von diesem oder jenem, stehe für dieses oder jenes, ist damit noch nichts darüber gesagt, was es als Bild, Objekt, Konzept, Geste oder Akt ausmacht. Das gilt im Ansatz für jede kulturelle Form, aber bei der Kunst steht dieser Punkt im Zentrum. Beim Kunstwerk geht es nicht so sehr um das Was als um das Wie“ (J. Heiser: Plötzlich diese übersicht, Claassen, 2007). Wir hören Musik, sehen ein Bild, lesen ein Gedicht. Die typische Frage auf der Verhaltensebene lautet: „Wie?“ also: „Wie ist das gemacht?“ Die Frage auf der Erfahrungsebene lautet: „Was?“, also: „Welche Erfahrungsqualitäten sind mit dieser Werk-Erfahrung verbunden?“ Dabei stehen Werk-Erfahrung und schöpferische Erfahrung in einem eigentümlichen Beziehungs- und Spannungsfeld. Schöpferische Erfahrung ist Antwort auf Werk-Erfahrung. Werk-Erfahrung ist Antwort auf schöpferische Erfahrung. Soll der Fokus auf der Erfahrungsebene liegen, treten aber sofort mehrere Schwierigkeiten auf: alle Erfahrung – außer der eigenen – bleibt für das Ich unsichtbar und ist nur aus Verhalten erschließbar. Auf der Erfahrungsebene sind wir für einander unsichtbar. Was wir über Erfahrung wissen, ist sekundär, übersetzt, nie unmittelbar. Und selbst in der Begegnung mit uns selbst ist die eigene Erfahrung dem Subjekt nur begrenzt „einsehbar“, sie wird verzerrt und fragmentiert aufgrund vielfältiger intra- und interpersonaler Prozesse. Selbst die eigene Erfahrung ist großenteils unsichtbar. Erfahrung ist die einzige Evidenz Und dennoch: „Erfahrung ist die einzige Evidenz“. So formuliert es der schottische Psychiater Ronald D. Laing in seinem Buch The politics of experience, zu Deutsch Phänomenologie der Erfahrung (Suhrkamp, 1972). Mit Bezug auf eine „Politik der Erfahrung“ soll verdeutlicht werden, dass es bei der Diskussion um die Definitionshoheit über die menschliche Erfahrung und die ihr eigentümlichen Erfahrungsqualitäten um eine eminent politisch geladene Problemstellung geht. (Die Geschichte der Psychiatrie ist ein hochinteressantes Lehrbeispiel dafür). Denn letztlich zielt die Frage nach der subjektiven Erfahrung allgemein und dem Sonderfall der schöpferischen Erfahrung bzw. nach der Abdankung des schöpferischen Subjekts, auf aktuelle gesellschaftliche Prozesse, welche das ökosystem der Einzel-Psyche zu regulieren und zu steuern suchen. Wenn wir beispielsweise keinen Begriff mehr haben von „schöpferischer Erfahrung“, bedeutet dies, dass eine ganz spezifische Form von Erfahrung negiert, gelöscht, als irrelevant, als Ideologie, als Täuschung abgetan wird. Als Ersatz steht die Erfahrung des „Machens“ bereit. Machen ist in, „Empfangen“ ist out. Man könnte noch andere Gegensatz-Paare finden, es geht aber immer um das Be- bzw. Ent-Werten spezifischer individueller Erfahrung durch verinnerlichte gesellschaftliche Normen, durch Anpassungsleistungen der Selbstwahrnehmung im Sinne von political correctness, etc. Reflektiert das Verschwinden der Schöpferpersönlichkeit und mit ihr das Verschwinden einer gesellschaftlichen Rede von der schöpferischen Erfahrung lediglich einen unumkehrbaren Prozess einer auf Egalität zielenden gesellschaftlichen Emanzipation, der die „Funktion“ der Kunst „durchschaut“ hat und ihr lediglich im Spiel der Entfunktionalisierung noch einen Platz zugesteht oder steht eine „Politik“ dahinter, die den „Schöpfer“ und damit eine bestimmte Form des selbst bestimmten Subjekts gezielt aus dem Spiel nimmt? Scheu Versucht man andeutungsweise eine historische Phänomenologie der Werk-Erfahrung, stößt man alsbald auf einen Begriff, der in der ästhetischen – und natürlich auch der politischen – Diskussion heute selten anzutreffen ist: den der Scheu. Es gibt (gab?) die Erfahrungsqualität der Scheu vor dem Werk und damit verbunden Werk-Erfahrung als Autoritäts-Erfahrung. Ist diese Scheu oder Scham vor der „Herrlichkeit des Werks“ Relikt einer subjektiv oder gesellschaftlich „unaufgeklärten“ Situation oder verweist sie auf eine Wirklichkeit, der wir uns – aus welchem Grund auch immer – einfach zu entledigen suchen? Diese Ehrfurcht oder „Scheu“ vor dem Werk speiste sich auch aus dem Wissen, dass dem Kunstwerk mystagogische Potenzen eigneten, bzw. diese durchs Kunstwerk erfahrbar waren. Das Werk führte ins Geheimnis der menschlichen Existenz, am Kunstwerk war ein Wissen um dies Geheimnis „festgemacht“. Ohne dass dieses Geheimnis je sich völlig eröffnet hätte. Hier wären als Beispiele die Werke der Vokalpolyphonie der Niederländer zu nennen, in deren „moderner“ Nachfolge etwa auch die Matthäus-Passion – trotz aller Glaubens-„Gewissheit“, aber auch beispielsweise die 4. Symphonie von Schostakowitsch entstand. Entsorgung Wenn die Existenz kein Geheimnis mehr birgt, bedarf es keiner Mystagogen mehr. Geheimnisvolles ist nur noch im Umfeld der Unterhaltungsindustrie erlaubt, sonst darf es nicht sein. Weil „das Geheimnisvolle“ missbraucht wurde, ideologisiert wurde, keine Frage. Aber wenn wir feststellen, dass bestimmte Erfahrungen, weil missbraucht, ideologisiert oder schlicht unbegreiflich, heute unter die totale soziale „Löschtaste“ geraten sind oder uns nur noch als ihre Karikatur oder als verkitschte Industrie-Ware begegnen und deren „originaler“ Wert nicht mehr tradiert, nicht mehr „öffentlich“ diskutiert und damit letztlich nicht mehr erfahrbar ist, welche Konsequenz hat dies? Einschub Nota bene: Für die meisten Musikhörer, Kunstliebhaber, Museumsbesucher, Leser, kurz: unser Publikum, hat „das Werk“ mit seiner Aura und seiner Ideologie nicht aufgehört, zu existieren. Und die Ideologie des Werks wird ja auch weiter vom Kulturbetrieb „bedient“, auch wenn die Aura des „Stars“ die des Werks weit gehend abgelöst hat. Für uns, für die Kunstschaffenden der „aufgeklärten“ Moderne, ist das Werk „schwierig“ geworden, peinlich, verdächtig. (Hier liegt vielleicht ja auch einer unter vielen Gründen des Zerwürfnisses zwischen Publikum und „neuer Musik“). Es gilt also eine „besitzbürgerliche“, verdinglichte Vorstellung vom Werk zu trennen von der Wirklichkeit der Werke, die immer schon eine verborgene war, und um die es mir hier geht. Rechtfertigungsdruck Versucht man sich gedanklich dem schöpferischen Prozess zu nähern, so taucht „automatisch“ ein Imperativ auf, keinesfalls das Dunkel, das dieser Prozess im Kern enthält, zu mehren, keinesfalls die Distanz, die diesen Kern umgibt, zu wahren, sondern, wie selbstverständlich, gehen wir davon aus, dass dies ein zu erhellender Prozess sei, und ebenso selbstverständlich stellt sich die Frage, ob da überhaupt Dunkel ist bzw. sein darf. Vor der Autorität der Werke und der Schöpfung klagt unsere politische Korrektheit ganz besonders vehement „Verstehbarkeit“ und also Aufklärungspflicht ein, ja wir sehen uns einem Verstehenszwang ausgesetzt und unversehens haben wir eine Erklärbarkeitsverpflichtung unterzeichnet, mit der wir uns auf den Weg machen, diese Autorität zu untersuchen. Denn ein Stehenlassen eines Geheimnisses würde womöglich ein Anerkennen eines Geheimwissens bedeuten und damit Anerkennung von Macht außer Reichweite unseres Bewusstseins. Die ästhetische Erkenntnisfrage ist also spätestens hier ganz entschieden Machtfrage. Politisch korrekt ist es, Begriffe wie Schöpfung, Schöpfer, Autor unter einen sehr viel stärkeren Rechtfertigungsdruck zu stellen als beispielsweise Begriffe wie Erfindung, Konzept. Machen muss sehr viel seltener sich hinterfragen lassen als Hervorbringen. Die Frage nach der Macht der Erkenntnis ist untrennbar mit der Erkenntnis der Macht verbunden. Gefragt sind im öffentlichen Diskurs derzeit „Dienstleistungen des Durchschauens und des Misstrauens“, in der ästhetischen Debatte „ein familiäres Mitreden am Werk“, wie es der Schriftsteller Botho Strauß formuliert. Und nur allzu häufig und quasi Not gedrungen bleibt man bei der Frage nach dem Sinn ästhetischer Gebilde lediglich im Spiel des Austausches der gegenseitigen Erklärbarkeitsverpflichtungen verhaftet, statt Kategorien zu erarbeiten, mit denen sich eine Demarkation von Erklärbarem und Nicht-Erklärbarem leisten ließe. Totalisierte Verstehenserwartung Dies erscheint wichtig, da es hierbei auch um die Abgrenzung von Verfügbarem und Unverfügbarem geht. Allein: Wie es die Totalisierung der Verstehenserwartung zu einer totalitären Verstehbarkeit und damit totalen Verfügbarkeit gibt, gibt es die Mystifikation des Nicht-Erklärbaren, Nicht-Verfügbaren. Man ist – die Argumente welcher Seite auch immer abwägend – schnell in schlechter Gesellschaft. Im Hintergrund steht aber die Ahnung: Das Totalitäre bedarf heute in den so genannten entwickelten Gesellschaften nicht mehr der brachialen Gewalt, um zu herrschen sondern es herrscht und manifestiert sich sozusagen wie von selbst als das medial hergestellte und kontrollierte unbewusste Einverständnis der Menschen, sich nur noch bestimmten Erfahrungen auszusetzen, bestimmte Erfahrungen zuzulassen, und diese als die „eigenen“ auszugeben und andere zu verwerfen. Unter der Hand ist der medial entkernte Verbraucher von industriell hergestellten Erfahrungswelten entstanden, dem diese Surrogate als die eigenen und „eigentlichen“ verkauft werden. Welche Rolle spielt hier das sich dem Einverständnis widersetzende Werk? Schöpferische Erfahrung „Der schöpferische Atem kommt aus einer Zone des Menschen, in welche der Mensch nicht hinabsteigen kann, selbst wenn Vergil ihn führen würde, denn auch Vergil würde da nicht hinabsteigen.“ Eine solche Formulierung, wie sie Jean Cocteau in seinem Tagebuch festgehalten hat (zitiert nach George Steiner: Von realer Gegenwart, Hanser 1990), kommt uns heute sehr fremd vor. Der Autor schrumpft. Sein Standort schwindet. Spirituell und materiell. Wie auch das Werk. Es wurde zu: „Material in einer bestimmten Anordnung.“ Dem Autor/Erzeuger steht heute die Schnittstelle, das austauschende Netzwerk gegenüber. Den ersten konstituiert(e) „Abgeschiedenheit“ mit den Existenzformen Einsamkeit/Sonderlichkeit, ihm zugeordnet war ein Raum der Stille/Leere und eine Lebensordnung, die dem benediktinischen „secum habitare“ (bei sich wohnen, bei sich sein) sehr nahe stand. Bestimmend für den zweiten ist das teilnehmende Eintauchen in die community, das Beteiligtsein an Prozessen, das „Ausstoßen-Verbinden-Austauschen-Permutieren-Vervielfältigen-Verknüpfen“ – der Knoten. Mit der Kurzfassung der ersten Position haben wir die Kurzfassung der Bedingungen, unter denen sich – nicht nur in unserer Tradition – philosophische, religiöse und künstlerische Erfahrung artikuliert hat; bis vor kurzem, so will es scheinen. Mit der Kurzfassung der zweiten Position haben wir die Webtechnik des Netzes, das Heute. Welche schöpferische Erfahrung charakterisiert die erste Position?
Es geht bei der sprachlichen Fassung dieses Werkbegriffs also nicht so sehr um Bedeutungsfelder der Herstellung, sondern um semantische Felder, die mit Auffinden, Enthüllen, Begegnen, Freilegen zu tun haben.
Vor-Licht, Vor-Ton, Vor-Form Der bereits zitierte Ronald Laing hat die schöpferische Erfahrung wie folgt beschrieben: „In der schöpferischen Erfahrung erfahren wir die Quelle erschaffener Bilder, Skizzen, Töne als in uns und doch jenseits von uns. Farben fließen aus einer Quelle selbst unerleuchteten Vorlichts, Töne aus der Stille, Skizzen aus der Formlosigkeit. Dieses vor-geformte Vor-Licht, dieser Vor-Ton, diese Vor-Form ist Nichts und doch die Quelle alles Geschaffenen“ (a.a.O.). Damit nimmt er Bezug auf eine Tradition von Platon bis Hegel. Im Phaidros heißt es über den schöpferischen Prozess: „dass ich aus fremden Strömen durch Zuhören angefüllt worden bin wie ein Gefäß.“ und im Ion, einem weiteren sokratischen Dialog, formuliert Platon: Die Einheit von Sein und Nichts Was der Mythos im Bild der göttlichen Inflation fasst, bannt Hegel ins Bild einer Dialektik von Nichts und Nicht-Nichts. Er schreibt in der Wissenschaft der Logik: „Der Anfang ist nicht das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem Etwas ausgehen soll. Es ist noch Nichts, und es soll etwas werden, (...) ist die Einheit von Sein und Nichts, – oder ist Nichtsein, das zugleich Sein, und Sein, das zugleich Nichtsein ist“ (zitiert nach George Steiner: Von realer Gegenwart, a. a. O.). Das Anfangende ist: „Sein, welches Selbstbewusstsein geworden ist.“ Das Kunstwerk entsteht quasi am Ort des Wechsels zwischen Nichts und Sein, Sein und Auslöschung, ist unlösbar in diese Dialektik verwoben. Das Kunstwerk ist sowohl Schauplatz als auch Träger dieses Wechsels. Jedes Werk trägt die Freiheit in sich, nicht zu sein. So gesehen, vollzieht jedes Werk als Werk die Dialektik von Entstehen und Auslöschung. Die Gewalt des Nichts-Seins ist im Werk ebenso am Werk wie die Kraft des Seins. Deshalb trägt das Werk, wie verborgen auch immer, seine Abdankung wie ein Erkennungszeichen. Beispielhaft wäre hier die Integration von „Dekompositionsprozessen“ (Konsequenzen der motivischen Arbeit) bei Beethoven oder Bruckner in die Architektur ihrer großformatigen Werke zu nennen, man muss gar nicht die romantisch-fragmerntarische Kleinform des inetrmezzo oder Impromptu als hierfür typischer Werkcharakter anführen. Eine Komposition wie Prometeo von Luigi Nono böte reiches Anschauungsmaterial, ebenso wie umgekehrt die Dialektik von Sein und Nicht-Sein erfahrbar wäre an den konzeptualistischen Auflösungstendenzen in den Arbeiten Helmut Lachenmanns, die wiederum als schöpferischer Impetus zum „Werk“ drängen. An den „Malen“ der Selbstüberschreitung als Zeichen der eigenen Abdankung ist das Werk als Werk zu erkennen, nicht an seiner Objekthaftigkeit, seiner Kanon-Fähigkeit oder irgendeiner anderen Verankerung im kulturellen Gedächtnis. Ein abgelegenes, für mich aber inspirierendes, weil atypisches Beispiel sehe ich auch in der „Rhythmuskomposition“ der achten Symphonie Beethovens. Rhythmus als „Stoff“ der Komposition, allein dies zeigt schon ein überschreitendes. „Gegebenes“ (rhythmische Muster) wird ins Werk als „Setzung“ aufgenommen und in einer „Monomanie der Verarbeitung“ zur äußersten Verdichtung im motivischen Gewebe geführt bei gleichzeitiger Auflösung oder zumindest Untergrabung der auf dialektischer Balance fußenden klassischen Form- (und damit Seins-)Idee. Wie gesagt, Verankerung im kulturellen Gedächtnis ist sekundär, primär ist die Werk-gebundene „Fassung“ der existenziellen Ambivalenz als implizite Abdankung des Gegebenen. Erst durch diesen, der Dialektik von Sein und Nicht-Sein abgewonnenen Wirklichkeitswert erhält das Werk seinen „Adel“ als ein Objekt, an dem sich ein Schein von Wahrheit festmachen kann. (Nota bene: Diese Art der Abdankung hat nichts gemein mit der im zudiktierten Abdankung im Sinne von antiquiert, überholt, nicht zeitgemäß). Werkerfahrung Werkerfahrung (bzw. ästhetische Erfahrung im allgemeinen Sinn) ist dialogische Erfahrung, die von der oben angedeuteten doppelten Wirklichkeit des Werkes geprägt ist. (Das Werk tritt als geschlossenes Ganzes mir gegenüber und signalisiert mir dabei gleichzeitig sein Nicht-Sein-Müssen). Werkerfahrung ist einerseits Begegnung mit einer selbstevidenten Autorität, aus der sich das klassische „gnoti se auton“ (erkenne Dich selbst) mit der impliziten Aufforderung zur Metanoia (Veränderung, Sinneswandlung) herleitet, andererseits Begegnung mit der impliziten Selbsthinterfragung dieser Autorität, da sie – als Werk ins Werk gesetzt – ihr Sein als Artefact nennt. Werk-Autorität speist sich einerseits aus ihrer Bezogenheit auf den Tod und andererseits aus einer speziellen Erfahrung von Freiheit. Bezogenheit auf den Tod insofern, als das Werk abgeschlossen und endlich ist bzw. die am Werk gemachte ästhetische Erfahrung existenzielle Erfahrungsqualitäten von Endlichkeit (Anfang, Ende, Kontinuität, Diskontinuität, Entwicklung, Wandlung) vorstellt oder in uns belebt und indem es mehr oder weniger deutlich auf sein „Nichtsein-Können“ verweist. Insofern ist ästhetische- nicht von ontologischer Erfahrung zu trennen. Spezifische Erfahrung von Freiheit andererseits, weil das Werk per se der Akt der Freiheit ist, weil es keinen wahren weiteren Grund gibt, dass es ist. Dabei ist die im Werk erfahrbare Freiheit eine undurchdringliche, wir begegnen einer aus sich selbst evidenten Unmittelbarkeit. Der Kulturphilosoph George Steiner nennt das „Gegenwart einer strahlenden Undurchdringlichkeit“. Adorno spricht im Zusammenhang mit Beethovens Musik von „höchster Evidenz bei völliger Rätselhaftigkeit“. Diese selbstevidente rätselhafte Unmittelbarkeit ist wiederum der Kern unserer Selbsterfahrung, die wir erleben als „radikal unerklärliche Faktizität des Geschaffenen“. In einer solchen Phänomenologie der Werk-Erfahrung ist der schöpferische Akt ein metaphysischer Akt. Nach George Steiner ermöglicht er „eine Begegnung mit einer Logik des Sinns, die von anderer Art ist als die Logik der Ratio, mit einer Logik, die lebendige Formen hervorbringt. Der Schöpfungsakt ist zusammen mit dem, was er hervorbringt, von zwei primären Attributen gekennzeichnet. Er ist eine Verwirklichung von Freiheit. Er ist vollständig ungebunden. Seine Existenz schließt implizit und explizit die Alternative der Nichtexistenz ein. Das Vorangehen und die ständige Potentialität des Nichtseins sind es, die der Schöpfung ihr Wunder der „Gegebenheit“ und ihre verletzliche Wahrheit verleihen.“ (G. Steiner, a. a. O.) Das Abwesende Konzept und Erfindung als Feld der Selbstreferenz und angefüllter Positivität stehen der auktorialen Schöpfung gegenüber, die als Feld der Verweisung als angefüllte Negativität sich auf Abwesenheit und Andersheit bezieht. Gehört zum Werk und zur abgeschlossenen Form die Dialektik der Negativität mit ihrem Verweis auf die Freiheit des Seins bzw. des „Auch-nicht-sein-könnens“ so will die Erfindung, das Konzept auf den ersten Blick nichts anderes sein, als was es ist. Aber auch hier, so scheint mir, ist im „Gemachten“ ein wie auch immer winziger Impuls zur Selbstüberschreitung aufzufinden, der auch der Inszenierung des ready made als ephemerem Zufall eine Dialektik von Permanenz, also Werkhaftem, beigibt. Man kann dieser Dialektik aber noch eine weitere Wendung geben. Der Nobelpreisträger Imre Kertesz zitiert Kafka: „Das Negative zu tun, ist uns noch auferlegt. Das Positive ist uns schon gegeben“ und fährt fort: „So gesehen wäre alles Außerordentliche an Form und Idee einer Weigerung entstanden, dieses Negative zu vollziehen. Kunst, Philosophie, Religion: Produkte eines Innehaltens, eines Zauderns gegenüber der eigentlichen Aufgabe – der Zerstörung, und dieses Zaudern erklärte die unheilbare nostalgische Traurigkeit der wahrhaft Großen.“ Kertesz sieht übrigens seine eigene Arbeit als Möglichkeit, „im Gegebenen Raum schaffen für das Abwesende“ (alle Zitate aus: Imre Kertesz: Ich – ein anderer, Rowohlt, 1998). Steiner nennt philosophisches Denken und poetisches Schaffen „Samstagskinder. Sie sind einer Unermeßlichkeit des Wartens und Erwartens entsprungen.“ (a. a. O.) Dekonstruktion Vor diesem Hintergrund erscheint die Demontage der Kunst als auktorialer Schöpfung als das Satyrspiel nach der Tragödie. Datierbar auf das Jahr 1913 mit einer Aktion Duchamps, als dieser einen Trichter zum Abfüllen von Sidre signierte und ihm damit Werkcharakter zusprach. Doch ist die Thema der Dekonstruktivisten wirklich neu? Wenn Duchamps als „erster“ mit seinen Readymades den Begriff des Kunstwerks in Frage stellte, was anderes hat Rembrandt in seinen Gemälden der letzten Jahre, was hat Beethoven in seinen letzten Streichquartetten getan oder Bruckner in seinen Symphonien? Ist das „In-Frage-Stellen“ der Form, der Gattung, des „Werks“ nicht integrales Thema der Kunst, der Musik, der Literatur? Noch einmal: es bedarf des Werks, um das Werk in Frage zu stellen. Ebenso wie es des Subjekts bedarf, um das Subjekt zu übersteigen – nicht zum übermenschen nietzscheanischer Prägung sondern zum spirituell „erwachsenen“ Subjekt. Wie das Werk im Werk abdankt, um zum Werk zu werden, so dankt das schöpferische Subjekt als „Ich“ ab um zum „Selbst“ zu werden, um so Anschluss an eine transzendente Wirklichkeit zu finden – zu der das Kunstwerk nach alter Tradition „ein Fenster“ sein kann. Wenn es der Revolution der Moderne (und noch einmal sei Duchamps als Zeuge genannt) nicht um die Objekte, nicht um die Aufwertung der Trivialgegenstände zu ästhetischen Werken ging, sondern „um eine experimentelle Wahrnehmung“, und wenn die Aktionen der Installationen (sei es klanglichen, bildhaften oder skulpturalen Gepräges) als „Wahrnehmungslabore“ verstanden werden sollen, was ist gewonnen? Ließe sich diese „experimentelle Wahrnehmung“ nicht auch am traditionellen Kunstwerk schulen, ist die Zeitstruktur in einem Beethovenschen Variationensatz, sind die Motivketten eines Feldman, ist Nonos Streichquartett, durchaus ein Stück mit „Werkcharakter“, nicht auch ein Wahrnehmungslabor, wenn man sich auf die innere Dialektik von Anwesenheit und Abwesenheit in diesen Kunstwerken einließe? Hat sich die Konzeptkunst nur nicht mehr die Zeit gegönnt, den Moment der Selbstaufhebung in den großen Werken der Tradition und Gegenwart wahrzunehmen und munter einen Windmühlenkampf entfesselt gegen die ideologisch-positivistische Verzerrung in Darstellung und Wahrnehmung der „werkgebundenen“ Vergangenheit? Und damit mehr zerstört als „befreit“? Nicht einmal das Element der Konzeptkunst, das sofort ins Auge sticht ist neu: Kunst als Kommentar. Auch den gabs immer schon, und immer schon als schlechte Kunst. Die Collage der Wirklichkeit ist schwächer als die Wirklichkeit. Das penetrant Belehrende der Konzeptkunst eines Damien Hirst oder Jeff Koons, um willkürlich einige bildende Künstler der Gegenwart herauszugreifen, reicht nicht an die unterminierende Kraft der Werke des abstrakten Expressionismus eines Barnett Newman oder Jackson Pollocks heran. Messianische Potenz „Die Tatsachen der Welt sind nicht das Ende der Sache.“ – Dieser Satz von Wittgenstein verliert für die geschlossenen Systeme eines puren Konzeptualisten ebenso seine Bedeutung wie der Aspekt des „Außer-Reichweite-seins“, der unserer Existenz den „Puls der Unerfülltheit“ verliehen hat, wie Steiner es formuliert. Die „Irrationalität der transzendentalen Intuition“ ist dann überflüssig, weil alles in Reichweite ist, sich zur Verfügung hält und stellt bzw. weil das, was außer Reichweite ist, nicht zählt. Steiner schreibt: „Der Niedergang des Messianischen korreliert mit dem Aufkommen nicht-repräsentationaler Kunstformen. Die De-Konstruktion ist die zwingende Antwort und der zwingende Ausdruck des Ent-Bauens klassischer Sinnmodelle“ (a. a. O.). Aus dieser Dichotomie hilft vielleicht ein Verweis auf ein Verständnis des Messianischen, wie es eben der italienische Kulturkritiker Giorgio Agamben in seinem Kommentar zum Römerbrief Die Zeit, die bleibt formuliert hat (Suhrkamp, 2007). Er zitiert 1 Kor 7, 29-32 mit der berühmten Formel des „hos me“, des „als ob nicht“: „Was bleibt, ist, damit die Frauen Habenden als ob nicht Habende seien, und die Weinenden als ob nicht Weinende und die sich Freuenden als ob nicht sich Freuende und die Kaufenden als ob nicht Behaltende und die die Welt Nutzenden als ob nicht Nutzenden. Es vergeht nämlich die Gestalt dieser Welt. Ich will jetzt, dass ihr ohne Sorgen seid“. (zitiert nach Giorgio Agamben: Die Zeit die bleibt, Suhrkamp 2007). Agamben fährt fort: „Hos me, ‚als ob nicht’, das ist die Formel des messianischen Lebens. ... Das hos me ist die Spannung der Wirklichkeit. ... Es nennt das Vorbeigehen der Gestalt dieser Welt“ (a. a. O.). Könnte nicht dieses „hos me“ der Wesenskern dessen sein, was ich als das „Werkhafte“ zu umschreiben gesucht habe? Und damit der Wesenskern der Wirklichkeit von Kunst und der Wesenskern eines Bildes von Wahrheit, von deren Ahnung wir berührt werden, wenn wir von Kunst uns berühren lassen? Schluss Die gesellschaftliche Emanzipation und – mit noch viel stärkerer Gewalt – die derzeit stattfindende kapitalistische Homogenisierung des Globus haben sich als große Entsorgungsunternehmen an die Arbeit gemacht, das Individuum von den Schlacken seiner Unmündigkeit – d. h. von seinen Bindungen familiärer, sozialer, religiöser, ethnischer Art etc. – zu befreien. Zu gewahren ist, dass am Endpunkt dieser, durch die Aufklärung angestoßenen Entwicklung, aber nicht das „mündige“, sondern ein seines Schicksals völlig entledigtes Subjekt steht, das sich dieser Schicksallosigkeit (Imre Kertesz) aber gar nicht mehr inne wird, sondern als total verfügbare und austauschbare Stanzform lediglich nach immer neuen Einpassungsformen sucht, die sein gesellschaftliches und ökonomisches überleben ermöglichen. Nach der geschichtlichen Phase der totalitären Homogenisierungsversuche breitet sich in Kunst und Gesellschaft eine neue, sehr viel subtilere Welle der Homogenisierung aus, die uns in einer rein ökonomisch determinierten Versuchsanordnung einem ewigen Experiment des Fortschritts unterwirft und das Subjekt mehr oder weniger erfolgreich auf ein reines Funktions-Ich reduziert. Erfahrungslos gefallen wir uns im Reden fremder Reden, im Tun fremder Taten und im Spielen fremder Spiele. Von Erwartung steht nichts mehr geschrieben. KUNST MUSIK, Heft 9, S. 9-20, Herbst 2007, ISSN 1612-6173 |
Die Kunst des Hörens I von Nikolaus BrassSchall, Geräusch, woher? Es gibt nichts Urtümlicheres für unser Gehör, nichts, das ihm gemäßer wäre, als: orten, von wo? Und blitzschnell entschlüsseln: Alarm oder Signal der Freundschaft? Die Ohraufgabe seit jeher. Jedes Hören wendet sich nach draußen und drinnen und ist aufs engste verkoppelt mit motorischen, physiologischen und seelischen Blitz-Reaktionen. Jeder Schall, jeder Klang, jeder Ton, jedes Geräusch geht durch den Filter unserer vorzeitlichen Akustik-Schaltanlage: Freund oder Feind? Die Welt und wir Wir wissen durch unsere Sinne von uns und von der Welt. Unser in der Welt sein macht für uns Sinn, da unsere Sinne sich mit uns so weit entwickelt haben, dass sie uns etwas sinnvolles von der Welt, der äußeren und der inneren, vermitteln. Wir hören immer, selbst in der Ohnmacht hören wir. Und der Gehörsinn ist der letzte, der uns verlässt, wenn wir sterben.
Unsere Akustik-Schaltanlage sichert aber nicht nur durch das Freund/Feindschema unser überleben: indem sie Schall „sortiert“, wird aus Schall Information. Unsere Sinne „ordnen“ Schall. Als (erinnerbare) Schall-Gestalt wird er spezifischer Klang und aus Klang wird (durch Instinkt und Erfahrung ) Information: Hörend gewinnen wir nicht nur Erkenntnisse über Freund oder Feind, Kampf oder Liebe, Futter oder Flucht, sondern auch: Hörend erkennen wir Klang als ein Kontinuum der Welt, in der wir leben und die wir selbst sind. Um mit dieser Welt des Seins und Selbstseins in Kontakt zu bleiben, tastet unser Instinkt und unser Geist unablässig dieses Kontinuum ab, um daraus durch Graduierung und Skalierung weitere Klang-Qualitäten zu gewinnen, welche vielleicht noch differenzierter Informationen über „Welt und uns“ bereithalten. Ein Sonderfall dieses Abtastens ist das Tasten der Musik. Musik schneidet in das Kontinuum von Klang, löst daraus Elemente (Oberton-Spektren, Geräuschspektren, Pulse, Metren, Rhythmen) und bildet daraus Gestalten. Das Ohr der Musik reagiert auf die Gestalten, die es im Kontinuum des Klangs findet. Wie das Ohr zunächst un- oder vorbewusst Klang organisiert, um ihm Informationen zu entnehmen, organisiert Musik (bewusst) Klang, um darin Informationen zu verschlüsseln. (Primär war wohl die Mimesis: keine „Verschlüsselung“ sondern einfach Mitteilung durch Nachahmung: Der Ruf des Büffels, der Schrei der Gans.) Musik organisiert Klang. Was als Ernst begann (Freund/Feind) wird über die Notwenigkeit und Lust an der Mimesis zum Spiel. Als strukturierte Gestalt steht Musik als historisch, kulturell, geographisch und sozial differenzierte „Organisation und Bändigung von Schall“ mit dem ursprünglichen Hören in direkter Verbindung. über den Schritt der semantischen Aufladung in Ritus und Kult entwickelt sie sich in immer reichhaltigerer Ausdifferenzierung hin zum freien Verfügen über und Spiel mit der ursprünglichen, atavistischen, biologisch gebundenen Freund/Feind-Hörerfahrung. Stand am Anfang die biologisch begründete Selbst- und Welterfahrung, wurde in Ritus und Kult die Organisation von Klang zum Spielfeld der religiösen und spirituellen Selbst- und Welterfahrung. Und Selbst- und Welt-Schöpfung. Und letztlich – aber innerlich immer noch gebunden an den zurückgelegten Weg über Ritus und Kult – entfaltete organisierter Klang in der uns heute geläufigen säkularen Welt eine weitere bestimmende Qualität: Musik als soziale Struktur. Differenzierung und Entdifferenzierung Befreit aus der ursprünglichen Bezogenheit auf die Kasten der Schamanen, Priester und anderer Personen „reservierter“ sozialer Orte, entfaltete sich die Musik in ihrem Weg durch die Zeit ubiquitär in höchst verschiedenen sozialen Kontexten. Dieser Gewinn wird aber bezahlt. Es scheint ein Grundgesetz von Entwicklung zu sein, dass immer weitere Differenzierungsschritte mit Entdifferenzierungsbewegungen zusammen gehen. Die soziale „Befreiung“ der Musik aus der „Hochkultur“ und massenhafte Verfügbarkeit war nur durch eine gewaltige Entdifferenzierung der Musik und damit eine gewaltige über- und Unterforderung unseres Hörsinns zu haben. überforderung, wenn man die Möglichkeiten der Schallverstärkung betrachtet, Unterforderung wenn man die unsägliche Einförmigkeit der musikalischen Zusammenhänge in der Popularmusik analysiert. Mit der vielfältigen Gebundenheit unseres Hörens kann eine Gesellschaft „emanzipatorisch“ oder „ideologisch“ umgehen. Und Ideologie, also „falsches Bewusstsein“ ist überall. Sicher war es nötig, der sogenannten Hochkultur den elitär hochgeknöpften Ideologie-Mantel abzustreifen und den Kunstgenuss der oberen 10 000 als das zu entlarven, was er war: eine Chimäre. Aber ohne die sogenannte Hochkultur sind wir verloren, wenn wir Wert auf Differenzierung und Weiterentwicklung, also fortschreitende Differenzierung unserer geistigen Sinne aus sind.
Das Paradox: Musik ist heute überall und (fast) nirgends. Das heißt: überall ist eine bestimmte Definition von Musik, die stark und erfolgreich von den atavistischen Reiz-/Reaktionsmechanismen der physiologisch codierten Musikerfahrung lebt und (fast) nirgends ist die Musik, die – jenseits von kommerziellen Verwertungsinteressen – an die geistig-spirituelle oder lustvoll-spielerische Selbst- und Welterfahrung durch Hören anknüpft. Was gefährden wir, wenn Musikerfahrung als Kunsterfahrung, und damit als Differenzierungserfahrung, lediglich ein gesellschaftliches Nischendasein fristet? Und was gefährden wir, wenn die Strukturen unserer Musikerfahrung (Konzert- und Opernhäuser, Ausbildungsinstitute) überwiegend museal konnotiert sind und nicht auf die Neuschöpfung ausgerichtet sind? Was gefährden wir, wenn wir den Zustand der sogenannten „Neuen Musik“ als kulturelles „Nischenprodukt“ akzeptieren? Was steht auf dem Spiel? Soziale Struktur
Musik kann je nach Kontext und Vokabular sowohl eine soziale Massenstruktur als auch eine differenzierte Binnenstruktur unter den Beteiligten (Spieler, Hörer) stiften.
Im ersten Fall ist sie Teil einer ideologischen Struktur (Ideologie ganz allgemein verstanden als Negierung von Differenz). In letztem Falle ist sie eine lebendige soziale Struktur, da sie über den „Motor“ Differenz- und Differenzierungs-Erfahrung Menschen in Achtsamkeit verbindet.
Der spezielle soziale Sinn der Musik bedarf der Pflege und Sorge. In der sozialen Struktur einer Stadt, eines Gemeinwesens braucht es „die Kümmerer“, die sich darum sorgen, dass sozialer Sinn entstehen kann. Der kann auf viele Art entstehen, einer davon ist lebendige Musik. Und im Falle der Musik können Kümmerer alle sein, die „Hervorbringer“ der Musik, die Komponisten und Musiker, das können die Institutionen sein wie Kulturreferate, Rundfunkanstalten öffentlichen Rechts, Veranstalter: die planen und Geld und Räume vorhalten. Die Kümmerer sind aber auch vor allem „die Empfänger“, also die Hörer selbst, wenn sie ihre Bedürfnisse artikulieren und die Begegnung suchen. So gesehen darf es keine Delegation an „Fachleute“ geben, die sich beispielsweise um „die Klassik“ oder „Neue Musik“ kümmern, sondern das ist eine Aufgabe, die von allen Beteiligten ein „Sich-Kümmern“ verlangt. Denn nur wenn alle Beteiligten sich als „Mitwirkende“ erleben, entsteht das, was ich als sozialen Sinn der Kunst, hier: der Musik beschrieben habe. Wo dies nicht gegeben ist, geschieht das, was sich dann „kulturell abspielt“, ohne sozialen Sinn, d. h. nur aus kommerziellem, repräsentativem oder manipulativem Interesse. Komponieren In welchem Kontext steht dann heutiges Komponieren? Als Komponist suche ich einen Weg in das Innerste von Musik.
Was ich wahrnehme: Dieses, jetzt, hier. Nehme ich in Achtsamkeit wahr, so geschieht dies in liebender Hinwendung zum Jetzt-Hier-Sein von Dingen, Lebewesen, Klängen oder Farben. Bezogen auf Musik heißt das: Achtsamkeit dem Ton gegenüber, ja dem Laut, seiner Dauer, seiner Farbe, seiner Dynamik, seiner Beziehung und Bezogenheit zu anderen Tönen oder Lauten, seinem Erscheinen und Verschwinden, seiner Anziehungs- oder Abstoßungskraft auf andere Töne etc., seiner Fähigkeit zur Verwandlung oder zur Unwandelbarkeit, seiner Fähigkeit, neue Verbindungen einzugehen oder sich diesen zu verweigern, und: die Achtsamkeit richten auf den klingenden oder nicht klingenden Zwischenraum zwischen den Klangereignissen, auf die Stille als die Matrix des Klingenden, die Färbung der Stille, und so fort. Achtsamkeit ist der Wesenskern schöpferischen Denkens. Schöpferisches Denken ist immer auch kritisches Denken, insofern die „anschauende Erkenntnis“ (Adorno) nicht auf die Verwertbarkeit der Dinge gerichtet ist, sondern auf deren Eigen-Ständigkeit. Schöpferisches Denken ist ethisches Denken, insofern jede so anschauend gewonnene Erkenntnis An-Erkennung der Differenz ist und so den Ver-Wertungs- und Ent-Wertungskreislauf durchbrechen hilft. Warten, Finden, Erkennen Komponieren (wie wohl jeder kreative Akt) ist liebevolles, vertrauendes Warten. Versammeltes Ausgerichtetsein auf etwas Abwesendes, das zunächst nur durch seine Abwesenheit erfahrbar ist. Das Finden und Erkennen der Musik führt keine Beute heim, sondern ist ein Verweilen bei den Dingen. Beim Komponisten sind „die Dinge“ Töne, Dauern, Tonbeziehungen, Obertonnuancen etc., beim Maler oder Bildhauer Entsprechendes. Als Komponist, „kaue“ ich die Dinge meiner Zuneigung, lasse sie auf meiner Zuge zergehen, die Töne, die Dauern, die Intervalle, wie früher der Weise die Worte kaute, immer wieder. Dadurch erschließen sich mir Zusammenhänge neu, im Vertrauen auf „Zusammenhang“. Das Neue gibt sich zu erkennen gerade im Vertrauen auf Zusammenhang mit „dem Tradierten“, nicht, wie im dekonstruktivistischen Ansatz, im Misstrauen der „Sinnkonstruktion“ des Tradierten gegenüber. Musikhören ist ein Eintauchen in die Musikzeit, die eine andere ist als die Minutenzeit. Musikzeit ist Erlebenszeit, die wie die Traumzeit anderen Gesetzen gehorcht. Sie gehorcht als Erlebenszeit der „Sinnzeit“, der Zeit, die es braucht, um einen Sinn zu entschlüsseln, zu „transportieren“, zu ver“sinnlichen“. Erinnern und vergessen Musik spricht als Gedächtnis. Immanent im Werk als individuelles Gedächtnis (durch die gestifteten Beziehungen) und werkübergreifend als kulturelles Gedächtnis, da jede musikalische Formulierung und Form sich auf schon geformte Formulierungen und Formen bezieht (positiv oder negativ) und diese in einer bestimmten Art fortspinnt. Als Gedächtnis- und Erinnerungswesen schafft Musik in ganz besonderer Weise und vielleicht dichter als jede andere Kunstform eine ganz besondere seelische Kohärenz, indem sie individuelles und kulturelles Gedächtnis über die Formelsprache signifikanter Symbole (das sind Tonverbindungen, Klangfarben, rhythmische Modelle etc.) verknüpft. Ist in musikalische Formeln vor allem Ausdruckhaftes eingeschrieben, so in musikalische Formen (seit der Klassik) vor allem: Zeit als Schicksal. Musikalische Formen sind (überwiegend) Erinnerungsformen.
Es gibt kein Bewusstsein ohne Niederschlag von Geschichte. Alle Formen des Ich-Sagens bzw. Nicht-Ich-Sagens sind sozial-geschichtlich gegeben. Bevor wir „Ich“ sind, sind wir „Sie“. „Sie“ sind vorher, vor uns. Wir sind von Ihnen. Im Ich ist das Vorher „geschichtet“ (bewusst oder unbewusst). Das Vorher ist im Ich. Und dennoch vollzieht sich jedes Leben und jedes Bewusstsein als ein singuläres. Ein singuläres Lebendiges. Jede individuelle Erfahrung ist gefiltert durch das Sediment der Geschichtlichkeit (hat daran Anteil) und ist gleichzeitig singulär. In dieser Spannung vollzieht sich künstlerische Vergegenwärtigung. Vergegenwärtigung Vergegenwärtigung wird erlebt als das aufscheinende Augenblickhafte des Lebendigen, gespiegelt in der Lebendigkeit meines Bewusstseins.
Das ist es, was auf dem Spiel steht. Die Musik-geschenkte Selbsterfahrung in einem umfassenden existenziellen Sinn, die unsere biologische und geistige Existenz gleichermaßen umgreift. Dieses Hören delegiert die Gesellschaft in die Nische. Wollen wir uns aber von der Kunst und der Fülle des Hörens wirklich verabschieden? 2013 erweitere und überarbeitete Fassung eines Beitrags für die Hamburger Klangwerktage, 2009, Programmheft Hamburger Klangwerktage, 22. - 27. 11. 2009 |
Die Verantwortung des Künstlers I Dankesrede zum Musikpreis der Stadt München I von Nikolaus Brass I 29. 7. 2009Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Küppers, verehrte Vertreter der Stadt München, liebe Freunde, meine Damen und Herren, dass diese Feier ohne Reinhard Schulz stattfindet berührt und bewegt mich sehr. Er hatte auf meine Anfrage im April, ob er für den heutigen Termin die Laudatio verfassen wolle, sofort zugesagt, gleich mit dem Zusatz: Aber vortragen muss das dann vielleicht ein anderer. Er war sich der Begrenztheit seiner Lebenstage sehr bewusst. Ich schulde Reinhard Schulz viel. An seinem Beurteilen, das nie ein Verurteilen war, habe ich viel gelernt. Gelernt, wie – abseits von aller journalistischen Geläufigkeit – über unsere Lage, d. h. die Lage der Kunst und hier: die Lage der Neuen Musik, nachzudenken Not tut. Sein Urteil wuchst aus dem Zentrum einer klugen, erfahrenen, lebensgestättigten Person und war gebettet in eine große Weite einer vitalen Wahrnehmungslust. Diese Lust wiederum war bestens vor Beliebigkeit gewappnet durch einen scharfen Verstand und – für mich das bestimmendste – durch ein untrügliches Gespür für Stimmigkeit, für die personale Glaubwürdigkeit einer künstlerischen Position. Dabei blieb sein Blick aufs „Ganze“, das heißt den gesellschaftlichen Bestimmungsrahmen und das, was die Kunst im Kunstbetrieb macht und umgekehrt, was der Betrieb aus der Kunst macht, ganz nüchtern und unverstellt.
Mit Reinhard Schulz fehlt künftig eine wichtige Stimme. Seine Worte, die wir gerade in der Laudatio gehört haben, gehen weit über den heutigen Anlass hinaus. Sie berühren die Frage unserer Selbstachtung. Und damit die Frage, welche Rolle, im privaten wie im öffentlichen Bereich, Achtung in unserem Leben einnehmen will. Und es folgt daraus die Frage nach der Aufgabe der Kunst in einer Gesellschaft, die sich anschickt, Achtung und achtsamen Umgang mehr und mehr einem globalen Zynismus des Zwecks zu opfern.
Aber gestatten Sie mir zunächst einige persönliche Worte zu der Auszeichnung, die mich völlig überrascht hat. Im Begründungstext wird suggeriert, ich hätte durch meine bisherige Arbeit München als Musikstadt bereichert. Ich denke, es ist gerade anders herum: die Musikstadt München hat mich bereichert und ich verdanke München sehr viel von dem, was mich musikalisch wesentlich geprägt hat. Das sind Orte und Menschen. Die Orte heißen: Stehplatz Herkules-Saal, Stehplatz Nationaltheater und Stehplatz Kongress-Saal im Deutschen Museum. Das sind die Orte, für die ich München wirklich dankbar bin, – auch wenn sie verwaltungstechnisch nicht alle München „gehören“ – , aber sie gehören zu dem, was für mich München ist, denn dort begegnete ich als Student – aus einer mich empfindsam vorprägenden Provinz kommend – der musikalischen Weltliteratur. Und zwar nicht virtuell nur im Notentext oder auf Schallplatte, sondern als Konzert- bzw. Aufführungs-Erlebnis. Und dieses Erlebnishafte der Musik und des Musikmachens, der lebendig-soziale Wesenskern der Musik hat mich ergriffen und dem habe ich bis heute nicht abgeschworen, den habe ich damals als „Ergriffenheit“ von Kunst gefunden und den finde ich auch immer wieder, gerade auch in München, trotz aller Gefährdung des Musiklebens dieser Stadt durch den Umschlag in eine übersättigte „Eventkultur“. Event ist das Gegenteil von Musik-Erleben, es ist das vorgefertigte Ver- und Ersatzstück von „Erleben“, das eigenständiges Erleben gerade unmöglich macht. Das andere, was ich München verdanke sind Begegnungen mit musikalisch bestimmenden Menschen und Mentoren, die mich bereichert haben und mich durch Interesse an und kritische Begleitung von meiner Arbeit haben wachsen lassen. Das sind Begegnungen eher am Rande des offiziellen Musikbetriebs, an den ich mich ja selbst auch ansiedele, aber vielleicht gerade deshalb so prägend. Hier zu nennen als frühe und wichtige Personen: Peter Kiesewetter an der Musikhochschule oder Helmut Lachenmann, den ich während seiner frühen Münchener Zeit kennen lernte, später die Begegnung mit Helmut Rohm am Bayerischen Rundfunk, der sich schon sehr früh für die Produktion meiner Musik eingesetzt hat, dann die Begegnung mit einem wachstumsfördernden Biotop wie der sog. „Freie Szene“, hier v. a. im Gestalt der „Münchener Gesellschaft für Neue Musik“, aus welcher Zeit auch die Freundschaft mit Reinhard Schulz rührt. Und nicht zu letzt, aber vor allem in den letzten Jahren, die Begegnung, Zusammenarbeit und Freundschaft mit großartigen Musikern, die mich durch ihre Interpretationen immer wieder mit der Wirklichkeit von Musik beschenken, wie es heute auch Gestalt wird mit dem Trio Coriolis, das für diesen Anlass nach einem neuen Streichtrio verlangte.
Lassen Sie mich aber noch einmal auf den Ausgangspunkt zurück kehren und damit zu dem „Sinn“ dieser Veranstaltung: wir besinnen uns auf eine mögliche Aufgabe von Kunst in Zeiten der Quote. Es geht um Achtung, Selbstachtung und damit um Verantwortung. In einem wechselseitigen Verantwortungsverhältnis von Künstler und öffentlichkeit muss es darum gehen, der Welt der Zwecke eine Welt der Achtung aus Achtsamkeit wenigstens entgegenzuhalten – dass wir die Gesamtheit unserer Lebens- und Arbeitsbeziehungen unter dieses Zeichen stellen, ist unwahrscheinlich und bleibt wohl Utopie, auch wenn es betörende Beispiele des Gelingens gibt, etwa in der Blütezeit monastischen Lebens in Europa. Achtsamkeit – übrigens eine völlig diesseitige übung – ist die Schule der Wahrnehmung dessen, was ist. Sie ist damit die Kritik des „als ob“ (und damit eine der schärfsten Kritiken überhaupt!).
In der speziellen Verantwortung des Künstlers liegen dabei drei Blicke:
Keine Kunst ohne diese drei, in der Diskussion ( und in der Ausbildung) sind meistens Blick 1 und 2. Aber das Streichquartett von Luigi Nono oder eine Motette von Josquin, Schuberts Klaviersonate B-Dur oder Bernd Alois Zimmermanns „Stille und Umkehr“, Beethovens op. 96 oder Feldmans coptic light : diese Werke sind nicht nur Zeugnis einer geschichtlichen Person, nicht nur Zeugnis eines analytischen, das Metier seiner Zeit und das der vorangegangenen Epochen durchdringenden Geistes, sondern Zeugnis einer bestimmten, eben „anderen“ Lesart der Welt. Lesart verstanden als Auflesen, Zusammenlesen, Versammeln. Dieses Lesen ist kein Lesen in Begriffen sondern in Begegnung. In dieser Art des Lesens ist Achtsamkeit, ist die Annahme des Gegebenen als Gegebenes, ist der liebende, nicht der zynische Blick auf die Endlichkeit des Menschen und seine Gebrechlichkeit, ist der liebende Blick auf die Fülle wie die Unwiederbringlichkeit gelebter Zeit. Erst dieser liebende Blick (der den persönlichen und den analytischen Blick durchtränkt) entscheidet darüber, ob Wahrheit in der Kunst ist, Wahrheit verstanden als das Erscheinen dessen, was ist, jenseits meines „Begriffs“ davon, jenseits meines Verfügens und meines Willens, es zu einem Zweck zu machen.
Dankesrede zum Empfang des Musikpreises der Landeshauptstadt München, Juli 2009 veröffentlicht unter : Dankesrede in: positionen - Texte zur aktuellen Musik, Heft 81, November 2009, S. 49 - 50. ISSN 0941-4711. Verlag Positionen, Großstückenfeld 13, 16567 Mühlenbeck b. Berlin www.positionen.net |
Geschichte und Erfahrung I Marginalien zu Komponieren und Bedeutung I von Nikolaus Brass
1. Musik denken Musik denken: seine Aufmerksamkeit richten auf etwas, das ohne mich existiert.
Musik ist.
Als Komponist suche ich einen Weg in ihr Innerstes.
Nur indem Klingendes vergeht, entsteht die Gestalt von Musik. Wahrnehmen Was ich wahrnehme: Dieses jetzt hier (Duns Scotus nennt es: Haecceitas, ein Dieses-Jetzt-Hier-Sein). Musik hören Dieses: die Faktizität des Tons (Frequenz, Spektrum, Schalldruck etc., die Welt der Parameter) Nebenbei: Punktualität hat auch Bezugsqualität: negative Bezugsqualität, ebenso wie „Atonalität“, Zufalls-generierte Musik, jede Spielart von „negativer Ordnung“ etc.. Musik als Werk: Die Anwesenheit des Abwesenden
Schöpferisches Denken Wachsein des Daseins für sich selbst (Heidegger).
Poetische Erfahrung „Die poetische Erfahrung ist der gemeinsame Blitzschlag von Dingempfindung und Zeitempfindung.“ (Wilhelm Genazino)
Was soll es bedeuten? Wir können nicht hören ohne Bedeutung. Ohne dass wir Bedeutung suchen, schaffen, erleben. Auch Unbedeutendes hat seine Bedeutung: ich bedeute nichts. Genazino: „Epiphanien sind für uns das, was uns zwar zufällig aber zwingend einfällt, wenn wir den Appellcharakter der Gegenstände wahrnehmen. Epiphanien sind, was uns momentweise erleuchtet und bewegt. Epiphanien nehmen wir als Möglichkeit von Sinn zwar ernst, setzten sie aber nicht absolut, weil wir von der Zufallswirklichkeit des Bewusstseins wissen.“ Vergegenwärtigung Die Dinge sehen (hören) im Lichte (Tönung) ihrer selbst und ihrer Auslöschung (Vergängnis). Der kreative Akt wie die ästhetische Wahrnehmung zielen auf Vergegenwärtigung. In der Versammlung des Bewusstseins auf Vergegenwärtigung werden ihm Momente der Vergegenwärtigung zuteil (geschenkt, ereignen sich, stoßen zu, offenbaren sich). In der Versammlung auf Vergegenwärtigung bringt sich das Bewusstsein zur Welt. Dieses Welt-Bewusstsein verdankt sich einer Anschauung, welche auf die je individuelle Gegenwart von Dingen und Personen zielt. Diese Wahrnehmung trifft auf „das andere“, „das Fremde“, „das Einmalige“ anstatt auf Kopien eines Musters. Warten, Erkennen Komponieren ist liebevolles, vertrauendes Warten. Wer hören will muss fühlen Verweilen.
Fetisch der Moderne Das Material. Statt vom Werk reden wir vom Material. Material in einer bestimmten Auswahl und Anordnung. Betonen die Ableitbarkeit, als ob das Ableitbare Gewähr für Sinn böte. Mehr Sinn vielleicht im Blitz als im Gerechtfertigten. Anfangen Nichts zwingt mich. Ist es das Nichts, das mich zwingt, anzufangen? Leere Dem nachhorchen, was als Resonanz nachschwingt. Das Klingende hineinhalten in das Vergehen. Das Vergangene finden, im Abdruck des Nicht-Mehr. Das Echo hören, nachdem es verklungen. Im Jetzt ein Immer spüren und spürbar machen, wie im Immer das Jetzt. Das Geschehene als Geschehenes da sein lassen, es aufspüren in seinem Gewesen-sein. Wiederholung Wieder holen. Das Einzelne wieder heim holen in den Focus der Wahrnehmung. Es als Einzelnes wieder und wieder her holen in den Brennpunkt des Bewusstseins. Oder: es durch sein wieder und wieder seiner vordergründigen Bedeutung entleeren, es als Litanei seiner selbst frei machen von jeder Konnotation und wieder neu „aufladen“ mit sich selbst. Erinnern und vergessen Musik spricht als Gedächtnis. Als Gedächtnis- und Erinnerungsform schafft sie in ganz besonderer Weise und vielleicht dichter als andere Kunstformen Kohärenz, indem sie individuelles und kulturelles Gedächtnis über die Formelsprache signifikanter Symbole verknüpft. In musikalische Formen ist Zeit als Schicksal eingeschrieben.
Musikalische Arbeit ist Arbeit am Abbild der Zeit. Körperliches ist Wiederkehrendes. Einatmen, ausatmen. Wachstum, Minderung.
Organisches vollzieht sich zyklisch, nicht unidirektional. Selbst die Erfahrung der unwiderruflichsten Unidirektionalität (geboren werden, sterben) bildet sich im Bewusstsein ab als Teil eines zyklischen Geschehens. Zyklische Zeiterfahrung: Erst und dann, einst (damals) und einst (künftig) fallen zusammen
2. Ist das relevant? Beliebte Frage meiner Generation.
Im Gewebe des fadenscheinigen Kulturmantels spielt „neue Musik“ höchstens die Rolle eines bunten Knopfs am Revers, wenn überhaupt – ganz im Gegensatz zur bildenden Kunst, mit der man heute „Staat machen“ kann. Bedeutungslose Musik Die offenbare gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit „neuer Musik“ ist u. a. aber auch Faktoren geschuldet, die in ihr selbst liegen und mit Dekonstruktion, Entsemantisierung und Materialfixierung mehrfach analytisch beschrieben worden sind. Bedeutung retten durch Zerstörung von Bedeutung: die den Diskurs der neuen Musik dominierende „Rede vom Material“ (statt der Rede von der Bedeutung) verdankt sich einem generellen Ideologieverdacht gegen Bedeuten und Meinen. Dieser ist zwar historisch verständlich, in seiner Einseitigkeit der Komplexität musikalischer Sachverhalte aber nicht zuträglich. Im Gefolge dieses zunächst Komponisten-induzierten Jargons monopolisierte der Materialfetischismus auch weite Teile der Rede der Musikvermittler (Veranstalter, Kritiker, Musikwissenschaft, Medien).
Struktur und Effekt Struktur zielt auf Differenz, Effekt zielt auf Reaktion.
Die Herrschaft des Effekts ist das ästhetische Signet des Konsumismus. Wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, verlangt Konsum nach Effekt und Effekt nach Konsum (Verbrauch, Steigerung, Vervielfältigung, etc.)
Für wahr nehmen Wenn man es heroisch formulieren will, kann man vielleicht eine „Relevanz“ künstlerischen Schaffens gerade in seiner gesellschaftlichen „Schwäche“ erkennen. In einem gesellschaftlichen Lügenzusammenhang, in dem die ökonomische Freiheit als die personale Freiheit ausgegeben – und auch so wahrgenommen – wird, kann jeder Akt, der auf Wahrnehmung als wahr-nehmen setzt, ein Akt von gesellschaftlicher Relevanz sein. Zufällig, endlich, rätselhaft Wahrnehmung als Thema setzt auf die Selbstwahrnehmung des Subjekts. Jenseits der Unterwerfung unter die ökonomischen Kategorien der Tausch- und Warenwelt und die ästhetischen Kriterien einer Reiz-Reaktions-„Kultur“ ist menschliche Selbstwahrnehmung gekennzeichnet und geprägt durch das Rätsel von Bewusstheit, Kontingenz und Endlichkeit. Diese Selbstbegegnung ist nur teilweise erträglich bzw. bewusstseinsfähig. Jede Epoche hat dafür Weisen der Bewältigung entwickelt. Jenseits von Reiz und Ablenkung haben sich Ritual, Kultus und Kultur herausgebildet, um mit dieser Grundzumutung umgehen zu lernen.
Erfahrung und Geschichte Es gibt kein Bewusstsein ohne Niederschlag von Geschichte. Alle Formen des Ich-sagens bzw. Nicht-Ich-sagens sind sozial-geschichtlich gegeben. Bevor wir „Ich“ sind, sind wir „Sie“. „Sie“ sind vorher, vor uns. Wir sind von Ihnen. Im Ich ist das Vorher „geschichtet“ (bewusst oder unbewusst). Das Vorher ist im Ich. Und dennoch vollzieht sich jedes Leben und jedes Bewusstsein als ein singuläres. Ein singuläres Lebendiges. Jede Erfahrung ist gefiltert durch das Sediment der Geschichtlichkeit (hat daran Anteil) und ist gleichzeitig singulär. In dieser Spannung vollzieht sich künstlerische Vergegenwärtigung, wie ich sie oben angedeutet habe.
Nikolaus Brass veröffentlicht in: MusikTexte - Zeitschrift für neue Musik, Heft 113, Mai 2007, S. 63 - 67, ISSN 0178-8884 |
Neue Musik in der Rechtfertigungsfalle I von Nikolaus BrassWenn das „Progressive“ zwar registriert aber abgelehnt wird, – geschenkt, gehört dazu. Wenn es nicht verstanden wird – o. k., Ausweis eben seiner Fortschrittlichkeit. Wenn es attackiert wird und verfolgt: scheußlich, aber „irgendwie“ verständlich. Aber wenn das „Progressive“ als solches überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird und in einem öffentlichen Diskurs für seine „Daseinsberechtigung“ erst kämpfen muss unter der Rechtfertigung, doch eigentlich von großer gesellschaftlicher Relevanz zu sein und an diese Behauptung Forderungen anschließt, es seien ihm Schutzräume zu reservieren, um überhaupt wahrgenommen zu werden und in seiner gesellschaftlichen Bedeutung zur Geltung kommen zu können – da ist doch einiges zumindest „dumm“ gelaufen, wenn nicht sogar schief, grundschief. Dumm gelaufen, das könnte die überschrift für so viele gesellschaftliche Entwicklungen sein, der letzten Jahre: Finanzmärkte, Eurostabilität, Prekariat, Privatfernsehen. Es sind die Läufe der Dummheit, die sich da verkörpern. In dem eben erschienen Suhrkamp-Band: „Blödmaschinen – über die gesellschaftliche Fabrikation der Stupidität“ geben die Autoren Markus Metz und Georg Seeßlen berückende Einblicke in ein komplexes und dialektisches Kraftwerk von verblödenden Klugheitsmaschinen und klugen Verblödungsapparaten. Wobei das Bild der „Maschine“ und des Apparats steht für die Herstellung einer „automatisierten“ Bereitschaft von Individuen, Gruppen oder Schichten, in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext sich (bereitwillig und unbemerkt) ein X für ein U vormachen zu lassen. Beispielsweise den „Nachrichten“ zu glauben, den Kapitalismus mit einem Naturgesetz zu verwechseln, „die“ Wissenschaft als Richtschnur für alle Lebenszusammenhänge zu akzeptieren, die „Ziehung der Lottozahlen“ mit den „Börsennachrichten“ gleich zu setzen (– und umgekehrt), oder ganz allgemein: „Unbedeutendem“ „Bedeutung“ beizumessen, nur weil ein bestimmter Code der Kommunikation dies signalisiert. Mit der guten alten Kritik der Unterhaltungsindustrie und der Mediengesellschaft hat das alles (noch) zu tun –, das Gewebe der gegenseitigen Abhängigkeit aber und des wechselseitigen Bedingens im stillschweigenden Einverständnis zwischen Produzent und Empfänger von Stupidität bedarf einer tieferen Analyse. In diesem gegenseitigen (und größtenteils) unbewussten Wechselspiel kann „Vernünftiges“ sehr schnell „dumm“ werden und „Dummes“ vernünftig erscheinen.
Nikolaus Brass I Mitglied im Vorstand der Münchner Gesellschaft für Neue Musik (MGNM) Neue Musikzeitung, Oktober 2011, S. 10 |
Der Mensch ist nur da ganz Mensch wo er spielt I Schillers heller Kopfstand im Dunkel unserer schlechten Erfahrung I von Nikolaus Brass Vorspiel Spiel von spil, spel. Grundbedeutung von Spiel ist Tanz Spiel: Jede Tätigkeit, die lediglich aus Freude an ihr selbst geschieht und keine praktische Zielsetzung hat. Spiel findet sich bei Tieren und Menschen. Das Spiel des Kindes beginnt mit der Beschäftigung mit sich selbst (Funktionsspiele) und führt im eigentlichen Spielalter (2-6 Jahre) zum Spiel mit Gegenständen (Spielzeug) und mit anderen Menschen (Gruppen-, Regel-, Rollen-, Reigenspiel) dtv-Lexikon „Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigeren Lebenskunst tragen.“ Exposition Diese so berühmt gewordenen Sätze über das Spiel, die Kunst und den Menschen schrieb Friedrich Schiller in den Jahren 1794/95 in seiner Schrift: „über die ästhetische Erziehung des Menschen – in einer Reihe von Briefen“. Die Resonanz dieser Schrift war enorm. Sie bestimmte das bürgerliche Zeitalter in seinem idealen Selbstbewusstsein und forderte verschiedene Versuche heraus, diese Art von Bewusstseinsbildung vom Kopf auf die berühmten Füße zu stellen. Eine (nicht nur) gymnastische übung mit unterschiedlichem Erfolg. Die kulturanthropologische Frage nach dem spielenden Menschen vibriert bis heute nach. Allerdings mutet uns heute der „spielende Mensch“ eher als die Inkarnation des Spiel- und Welt-„Verderbers“ an denn als ein Lebensentwurf, der den Zweckrationalismus – heute müssen wir sagen Zweckzynismus der Moderne – nachhaltig in seine Schranken weist. Schiller zielte mit dem in sich kreisenden Dreischritt: Spiel – Freiheit – Kunst, Kunst – Freiheit – Spiel auf eine Menschenbildung, die in Spiel und Kunst für ein „der Freiheit unempfängliches Geschlecht“ erst den Erfahrungsraum für freies Handeln und Empfinden bereitstellt. Erst im (lebenslangen) Durchlaufen dieser ästhetische Schule, die man auch eine „Selbsterfahrungsschule in menschlicher Freiheit“ nennen könnte, bildet sich der innerlich freie Mensch, der dann auch die soziale und politische Freiheit schafft. Denn das war Schillers Lehre aus dem Terror der französischen Revolution: Unfreie schaffen keine politische oder soziale Freiheit.
Zwischen Schiller und uns liegen gut zwei Jahrhunderte. Das Programm der „ästhetischen Erziehung“ als notweniges Kurrikulum vor einer „politischen Erziehung“: ist es durch die unselige deutsche Geschichte nicht endgültig diskreditiert? Die vermeintlich „ästhetisch Gebildeten“ war nicht gefeit vor Barbarei. Lohnt es sich dennoch Schiller neu zu lesen? Ich meine ja.
Durchführung Wo sehen wir Freiheit?, fragt Schiller. Er sieht sie nicht im Staat, er sieht sie nicht in der Revolte, er findet sie in der Schönheit. „Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung“. In der Erfahrung der Schönheit erkennen wir etwas wie „Selbstbestimmung“. Nur wenn keines der Elemente eines schönen Dings vergewaltigt wird, wenn das Einzelne harmonisch mit dem Ganzen zusammensteht, waltet Freiheit der Erscheinung. Schon einige Zeit vor den ästhetischen Briefen sieht Schiller (1793 in seinen Briefen an Körner) wie die Schönheit mit den Materialien „spielt“, so dass deren Eigensinn und Eigenwert zum Ausdruck kommt. „In der ästhetischen Welt hat jedes Element ein gleiches Recht und darf um des Ganzen willen nicht gezwungen werden, sondern es muss zu allem schlechterdings konsentieren“. Und auch der Künstler muss sich dieser Freiheit beugen und darf sich dem Material „nicht aufherrschen“. Erst wenn der Eigensinn des Künstlers und der Eigensinn des Stoffes sich verbinden, entsteht Schönheit. Und zu ihr gehört, dass es so scheint, als ob das Darzustellende es selbst sei, das zur Darstellung drängt.
Hören wir den politischen Subtext dieser Rede? Die Kunst also als „Schule der Erfahrung“ von „Selbstbestimmung“, als Schule, wir könnten auch sagen als „Trainingslager“ für politischen Vernunft?
Reprise mit Apotheose des ersten Hauptthemas Das Spiel befreit. Das Spiel der Kunst erzieht zur Freiheit. Deren Siegel ist die Schönheit. Schönheit als Freiheit in der Erscheinung. Das Spiel der schönen Kunst hält das Leben in der Schwebe, damit Schönheit erscheine. Das Spiel befreit von Abhängigkeit, von Verstrickung jeglicher Art: vom Anheimgegebensein an Affekt und Emotion gleichermaßen wie von Verstandesverliebtheit und analytischem Dünkel. Das Spiel spielt. Sich. Das Spiel des Spiels ist Freiheit. Freiheit ist das Schweben zwischen Gebundenheit und Ungebundenheit. Das Spiel spielt mit der Lust, dem Vergnügen, dem Eifer, der Fantasie und dem Empfindungsvermögen ebenso wie mit der Verschlagenheit, dem Ehrgeiz, der Aggression, der Wut. Als Spieler trete ich in eine Rolle ein und lasse diese wieder los. Ich spiele das Spiel und das Spiel spielt mich. Ja, das Spiel spielt mit meiner Freude und meinem Schmerz. Spielt mit mir und den anderen, mit meinen Grenzen und dem Grenzenlosen in mir. moll-transponierte Schlussgruppe Und die Wirklichkeit? Und der Künstler heute? Ein Spieler? Aber ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Auch in der ganzen Ambivalenz. „Der das Spiel beherrscht“ ... sich ins Rampenlicht zu setzen. Wer sich durchsetzt im Spiel der Marktkräfte, der hat Spielerqualitäten. Und mit ihm wird gespielt. Die ganze Unterhaltungsindustrie lebt vom Spiel der medialen Inszenierung, Erhöhung und Zerstörung von Künstleridolen oder vom Interaktions-Spiel mainstream gegen independent, vom marktgerechten Absetzen bestimmter sozialer „Stile“ gegen andere etc. Und die online-Werbeindustrie lebt vom Piraten-Geiz-ist-Geil-Blödmann-Spiel des massenhaften kostenlosen downloads. Und weil Verblödungsspiele offenbar in sind, spielt die Klassikindustrie heute das „bravo“-Spiel und handelt nur noch mit Hochglanz- Sternchenbildern statt mit Informationen über Musiker ... Rückmodulation in Dur Und gleichzeitig, zum Beispiel wir Musiker, was tun wir? Wir verabreden uns zum Spiel. Das hast Du schön gespielt. Ich hab mich verspielt. Spiels noch mal. Lass uns das noch mal spielen. Schon das Vokabular verrät, was wir tun. Wir spielen. Und was erfahren wir, wenn das Spiel „gelingt“? Dass wir etwas gefunden haben, etwas von uns selbst und etwas, das weit über und hinausreicht. Im „schönen“ Spiel ist mehr als der „schöne“ Schein. Schön ist, dass etwas aufscheint, nicht der Schein. Deshalb glaube ich auch (noch) an den Begriff der Schönheit, der in Wirklichkeit nicht ein Begriff, sondern eine begriffsübergreifende Erfahrung von Präsenz ist. Erfahrung von Freiheit, ja. Und der Komponist? Spielt er? Ja, er erfindet Spielregeln, die er dann verletzt. Er hantiert mit Spielsteinen, das sind Noten, Perioden, Module, Strecken, Farben und Stimmungen, vertikale und horizontale Kräfte, die er in Szene setzt, und die dann anfangen, mit ihm zu spielen. Spruch der Weisheit: Ich spielte auf dem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Wie kommt die Weisheit zu den Menschen? Als Spielende, sagt die Weisheitsliteratur des alten Testamentes. Wie kommt die Freiheit zu den Menschen? Im Angesicht der Schönheit, sagt die idealistische Philosophie. Das heißt: Im Angesicht einer menschheitsgeschichtlichen Daueranstrengung.
Denn heute ... Noch mal Seitenthema, Moll-Mediante
Heute scheint es, als hätten wir das Spiel vergeigt. Als hätten wir verspielt. Als hätten wir das Freiheitsmodell, welches das Spiel für uns bereit hält als ein Erkenntnismodell unserer Selbst – so versteht es Schiller – als hätten wir dieses Freiheitsspiel versemmelt. Vermehrungssüchtig wie indisches Springkraut haben die Mutanten Glücksspiel, Finanzspiel, Kriegs- und Killerspiel unser Bewusstsein vom Spiel überwuchert. Der Finanzjongleur ist der Spieler dieser Tage, ganz zu schweigen vom Killerspieler. Schiller sah die Natur des Menschen im Spiel aufleuchten, heute leuchtet lediglich das Flackerlicht der Spielernatur. Geschäftssinn und mechanistische Ordnung sollten „ausgespielt“ werden, heute spielen gerade diese Prinzipien uns an die Wand. Durch das Spiel sollte Distanz von Aggression und Minderwertigkeit gelernt werden, heute werden gerade in massenhaft verbreiteten Tötungsspielen Aggressions-Hemmungen spielend abtrainiert. Coda gloriosa in der Grundtonart Das Spiel behält seinen Zauber. Es geht nicht nur ein Schatten mit (der grauenvoll ist und an dem heute mehr verdient wird als an allen Hollywood-Spielfilmen) sondern ein Zauber: der Zauber des Mit. Das Miteinander ist der Zauber des Spiels. Was spielt ihr da? Darf ich mitspielen? Hans-Georg Gadamer betont in seiner Schrift: Die Aktualität des Schönen – Kunst als Spiel, Symbol, Fest wie Spiel und Spieldarstellung untrennbar in einander übergehen und einen unlösbaren kommunikativen Konnex stiften. Spiel ist Spieldarstellung. Spielen inkludiert in der Spieldarstellung immer ein Mitspielen (aktiv oder passiv, als Zuschauer, Hörer etc.). Das Spiel als zweckloses Verhalten wird als solches gemeint und ist nur in der Spieldarstellung das, was es ist. (Fußball, Tennis, Schach, Musik).
Nikolaus Brass überarbeitete und gekürzte Fassung eines Vortags beim Münchner Pfingstsymposion 2012, das unter dem Thema SPIEL stand.Vortrag gehalten auf dem Pfingstsymposion 2012 in München: SPIEL
|
Wozu komponieren? I von Nikolaus BrassVielleicht doch wegen der Blumen, sie kennen kein Wozu ...
Die Frage nach dem Wozu kann ich nur beantworten in einer Perspektive, die das „Wozu“ nicht kennt, in der Perspektive der menschlichen Freiheit.
Wir kennen Nachrichten von diesem Wagnis.
Komponieren heißt Beziehung aufnehmen mit diesen Nachrichten, die von der Freiheitsfähigkeit des Menschen künden. Der Komponierende lernt, diesen Nachrichten zuzuhören, er lernt, sie zu bedenken, er kaut an ihnen, er denkt darüber nach, wie die Nachrichten verschlüsselt sein könnten. Denn der Sinn ...? Er sucht die Verbindungen zwischen den Nachrichten, er sucht nach übersetzungen, Interpretationen, er flieht vor einer Nachricht. Aber immer wieder geht er zur „Post“ und erkundigt sich: Gibt es neue Nachrichten? Wer weiß, woher neue Nachrichten uns erreichen könnten? Und wer weiß, welche Nachrichten wir nie zu sehen und zu hören bekommen haben? Er sucht. „Weil es die Schönheit ist, durch die man zur Freiheit wandert“. Ist das der Code? Ist die Frage nach der Schönheit der Schlüssel zur Dechiffrierung der Nachrichten? „Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung“. Für Schiller (über die ästhetische Erziehung des Menschen) war „Schönheit“ eine Erfahrungstatsache. Und der Lernort der Freiheit. In der Erfahrung der Schönheit erfahren wir etwas von „Selbstbestimmung“. Nur wenn keines der Elemente eines schönen Dings vergewaltigt wird, wenn das Einzelne harmonisch mit dem Ganzen zusammensteht, waltet Freiheit in der Erscheinung, die jedem Einzelnen den „Spielraum“ gibt, als Eigenwert und Eigensinn zu sein. Zu erscheinen. „In der ästhetischen Welt hat jedes Element ein gleiches Recht und darf um des Ganzen willen nicht gezwungen werden, sondern es muss zu allem schlechterdings konsentieren“. Eine Welt der Zustimmung. Als eine Welt der Freiheit. Die gibt es nicht mehr. So. Den die Wirklichkeit der Werke ist deren „Herrlichkeit“. Die steht nicht auf dem Papier, sondern ist deren Vollzug in der Darstellung. Zur Darstellung kommt etwas Unverstelltes (wenn es gelingt): das „Erscheinen“, nicht das Scheinen. Auch wenn es immer nur „stückweis“ ist.
Wozu also komponiere ich? Um nicht dem Wozu zu erliegen. Nikolaus Brass I Mai 2012 Neue Zeitschrift für Musik, Heft 4, 2012, S. 35, Beitrag zum Thema: Wozu komponieren? |
Laudatio Nikolaus Brass I von Reinhard Schulz Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Nikolaus Brass, dem dieses Jahr der Musikpreis der Landeshauptstadt München verliehen wird. Ich kann gar nicht schildern, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich, wieder einmal ins Krankenhaus gezwungen, erfuhr, dass Nikolaus Brass diesen so schönen Preis erhalten würde. Und bald darauf erfuhr ich, dass mir die Laudatio zugedacht war. Warum diese aufrichtige Freude? Weil es – und darauf werde ich im Folgenden zu sprechen kommen – einen Freund, einen feurigen und stets kritischen Mitdiskutanten in Sachen Neuer Musik, und vor allem einen Aufrichtigen betraf. Laudatio zur Verleihung des Musikpreises der Landeshauptstadt München an Nikolaus Brass, verlesen am 29. 7. 2009
|
Nachlauschen beim Komponieren I Der Komponist Nikolaus Brass I von Meret ForsterNikolaus Brass wurde 1949 in Lindau/Bodensee geboren. Nach dem Abitur 1968 folgte ein Medizinstudium in München, gleichzeitig private Kompositionsstudien an der Musikhochschule. Nach einem Auslandsstipendium in Schottland setzte Brass das Medizinstudium in Berlin fort und absolvierte das Staatsexamen an der Freien Universität. Heute lebt und arbeitet er in München. Aufführungen seiner Werke u. a. bei den Donaueschinger Musiktagen, musica viva München, Festical Eclat, Wittener Tage für neue Kammermusik, Ultraschall-Festival in Berlin. Sie haben Medizin und Komposition studiert, waren als Arzt zunächst klinisch tätig, sind seit 1982 Redakteur einer medizinischen Zeitung und komponieren. Wie geht das alles zusammen?
Unbewusst?
Leben Sie in einem Zwiespalt?
Ihre Stücke von den 1980er Jahren bis heute lassen sich nicht unter einem stilistischen Oberbegriff subsumieren. Aber es gibt prägende Eigenheiten wie etwa jene Achtsamkeit auf kleine Formgestalten und Kernzellen, die durchgehört, gedreht und im zeitlichen Verlauf auch noch einmal anders beleuchtet werden. Sehen Sie da eine Kontinuität?
Inwieweit gibt es eine typische Herangehensweise an ein neues Stück?
Sie haben erst sehr spät – mit über Dreißig – Ihre Werke freigegeben, obwohl Sie vorher bereits komponiert haben. Warum? Einerseits gibt es den Bezug zu Paul Klee, andererseits…? Inwiefern ist die deutsche Vergangenheit des 20. Jahrhunderts immer noch eine Herausforderung für Sie? Reiht sich in diese Beschäftigung mit Leerstellen auch Ihre Komposition „Void II“ (2001) ein, die unter dem Eindruck von Daniel Libeskinds Berliner Museumsbau entstanden ist? Wie komponieren sie? Nach einem normalen Arbeitstag als medizinischer Fachredakteur? MusikTexte - Zeitschrift für Neue Musik, Heft 113, Mai 2007, S. 59 - 60.
|
|
Auszüge aus Kritiken zu SommertagSummen, wo die Worte fehlen, Die Oper Sommertag von Nikolaus Brass I Berliner Zeitung, 26. Januar 2015 I von Clemens HausteinVielleicht ist dies das stärkste unter vielen Argumenten für Nikolaus Brass' Kammeroper Sommertag: Die Spannung im Publikum lässt während der gesamten Aufführung nie nach. Alte und neue rote Fäden , Das Ultraschall-Festival stellt einmal mehr die Sprengkraft des Altenb gegen neue bunte Klangspektren I Neue Musikzeitung, Februar 2015 I von Isabel HerzfeldWie aus äußerster Reduktion Substanz entstehen kann war exemplarisch in der Kammeroper Sommertag von Nikolaus Brass zu erleben. (...) Was in der Regie von Christian Marten-Molnar als Synchonizität von Vergangenheit und Gegenwart dargestellt wird, welche Vielschichtigkeit seelischer Vorgänge und Beziehungen zwischen drei Männern und drei Frauen entsteht, wie sechs Musiker dies in kargen Linien, schroffen Akzenten und verstörenden Verdichtungen unterstreichen, kompakt und doch unmittelbar eingängig, das ist einfach großes Musiktheater.
Flirrendes Amalgam - Nikolaus Brass ’Sommertag' ist echtes Musiktheater Dem nachzuspüren und Ausdruck zu verleihen, was in, aber auch zwischen den gesungenen Worten angelegt ist: Das hat Opernkomponisten seit den Anfängen der Gattung beschäftigt. Mit großer Sorgfalt hat sich nun auch Nikolaus Brass mit seinem späten Opernerstling dieser immer wieder neuen Aufgabe gestellt. ... Textzeilen werden ab und zu an die Wände projiziert. Zusammen mit gesprochenen Passagen richten sie den Fokus zurück auf die Worte selbst, die vom Gesang oft in Frage gestellt, in Vokalisen und anderen textlosen Lautbildungen aufgelöst werden. Dass die gesprochenen Einwürfe in ihrer Nüchternheit dann stärker wirken als der kunstvolle, von den Neuen Vocalsolisten Stuttgart (Sarah Maria Sun, Truike van der Poel, Susanne Leitz-Lorey, Martin Nagy, Andreas Fischer) mit faszinierender Selbstverständlichkeit bewältigte Gesang, ist ein paradoxer, von Brass wohl bewusst in Kauf genommener Effekt. ... Das Publikum im Schweren Reiter feierte Solisten und Instrumentalisten (neben Gunter Prezel die großartigen Oliver Klenk, Joe Rappaport, Stephan Lanius, Kai Wangler und Fabian Strauß) genauso einhellig wie den Komponisten und das Produktionsteam. Jenseits der Worte: Nikolaus Brass’ Sommertag' Brass füllt die Leerstellen des Textes, die Pausen, das Sinnieren und Grübeln der verlassenen Frau mit verstörend intensiven Klängen auf. ... Das ist von großer Eindringlichkeit, wie auch die schauspielerische und gesangliche Leistung der Sängerinnen und Sänger, allen voran Sarah Maria Sun und Truike van der Poel als junge und alte Frau. Die Sänger sind auf sich selbst zurückgeworfen und müssen eine Geschichte allein durch ihren meist textlosen Gesang erzählen. Was ihnen dabei hilft ist die freie Anlage der Komposition in (...) Zeitrastern, innerhalb derer die Sänger den Notentext frei gestalten können und damit im Grunde wie Schauspieler die zeitliche Ausdehnung ihres Parts frei bestimmen. 'Sommertag' von Nikolaus Brass Die dritte Uraufführung klärt die Sicht. Im Schwere Reiter stehen endlich Wesen auf der Bühne, die Menschen ähneln – Figuren mit Abgründen und Widersprüchen, keine Kopfgeburten und Sprechblasenträger, mit denen die Uraufführungen der Biennale für Neues Musiktheater öfter zu nerven pflegen. 'Sommertag' meidet den Kardinalfehler vieler neuer Bühnenwerke. ... Das Schweigen öffnet einen Raum für Musik, den Brass mit intensiven Klängen füllt. ... Die Musik des 64jährigen Einzelgängers ist heftig, fast körperlich und intensiv. Wenn das Schweigen vielsagend tönt In der kargen Ausstattung von Katherina Kopp und der eng aufeinander bezogenen Personenführung von Christian Marten-Molnar entsteht 100 Minuten lang eine ungeheure Sogkraft. Die souveränen Sängerinnen und Sänger (...) und die ebenso fähigen Instrumentalsolisten erschaffen mit Nikolaus Brass’ Musikeinen Klangraum, der bald klaustrophobisch eng, bald von orchestraler Fülle und Weite ist. Das Publikum ließ sich mit hineinziehen und spendete dem Komponisten wie dem ganzen Team lang anhaltenden Beifall. Vom langsamen Erstarren in einer Welt ohne Sprache Eine überraschung war 'Sommertag' von Nikolaus Brass. ... Die Risikofreude, mit der Brass um Lösungen rag, faszinierte – trotz einiger Längen. Diese offensive Haltung lies das Gros der jungen Komponisten vermissen ... Die Quadratur des Kreises |